.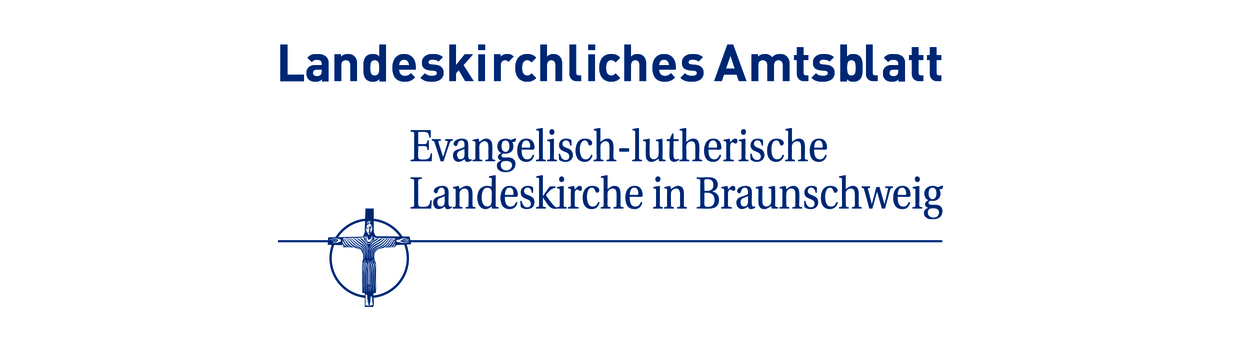
Abschnitt 1
#§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
Abschnitt 2
#§ 5
§ 6
#§ 7
Abschnitt 3
#§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
Abschnitt 4
#§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
Abschnitt 5
#§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
#Abschnitt 6
#§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
Abschnitt 7
#§ 33
§ 34
#
#
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
Bekanntmachung
§ 1
§ 2
§ 3
Bekanntmachung
§ 1
§ 2
Bekanntmachung
#Artikel 2
16. Änderung der Arbeitsrechtsregelung
Artikel 1
Nr. 3/2025Wolfenbüttel, den 1. Oktober 2025
Kirchenverordnungen
Nr. 47Kirchenverordnung
über den Kassenbetrieb und den Zahlungsverkehr bei kirchlichen Körperschaften in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig (KassenVO)
(RS 602.2)
über den Kassenbetrieb und den Zahlungsverkehr bei kirchlichen Körperschaften in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig (KassenVO)
(RS 602.2)
Vom 20. August 2025
Die Kirchenregierung hat aufgrund von Artikel 98 der Verfassung der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig in Verbindung mit §§ 30 Absatz 11, 38 Absatz 2, 38 Absatz 5, 39 Absatz 2, 42 Absatz 4, 44 und 81 Absatz 1 des Kirchengesetzes über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig (HKRG) vom 22. November 2019 (ABl. 2020 S. 102), geändert am 25. November 2022 (ABl. 2023 S. 14) folgende Kirchenverordnung erlassen:
###Abschnitt 1
Organisation
#§ 1
Kassenleitung
(
1
)
Die Kassenleitung ist für die ordnungsgemäße, zweckentsprechende und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte verantwortlich.
(
2
)
In Fällen des § 2 Absatz 1 Buchstabe e) und f) setzt die Kassenleitung die für die Kassenaufsicht bestellte Person über die Gegebenheiten in Kenntnis.
#§ 2
Kassenpersonal
(
1
)
Das Personal der Kasse ist insbesondere verpflichtet,
- in seinem Arbeitsbereich sorgfältig auf die Sicherheit der Kasse und des Kassenbestandes zu achten,
- die Datenerfassung unverzüglich vorzunehmen,
- die angeordneten Einnahmen und Ausgaben rechtzeitig und vollständig zu erheben oder zu leisten,
- für eine schnelle Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse zu sorgen,
- die Kassenleitung unverzüglich zu unterrichten, wenn sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und
- Mängel oder Unregelmäßigkeiten im Bereich der Kasse der Kassenleitung mitzuteilen.
(
2
)
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kasse dürfen nicht
- eigene Zahlungsmittel oder Wertgegenstände in Kassenbehältern aufbewahren und
- ohne Genehmigung der Kassenleitung Zahlungsmittel oder Wertgegenstände außerhalb der Kassenräume annehmen.
(
3
)
Zahlungsmittel und Wertgegenstände dürfen nur von den hierfür Beauftragten entgegengenommen werden.
(
4
)
1 Die mit der Buchhaltung und die mit dem Zahlungsverkehr betrauten Personen sollen sich regelmäßig nicht vertreten. 2 Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der zuständigen Stelle (§ 1 Absatz 2 HKRG).
#§ 3
Geschäftsverteilung
Die Geschäftsverteilung in der Kasse ist durch die zuständige Stelle zu regeln.
#§ 4
Dienst- und Fachaufsicht
(
1
)
Die Dienstaufsicht über die Kassenleitung führt eine durch die zuständige Stelle beauftragte Person (Kassenaufsicht).
(
2
)
Die Kassenleitung führt die Dienst- und Fachaufsicht über das Kassenpersonal.
(
3
)
1 Die Kassenaufsicht ist Bestandteil der Fachaufsicht und dient der Kontrolle über den Ablauf der Geschäfte in der Kasse und der Einhaltung der Kassensicherheit. 2 Im Rahmen der Kassenaufsicht ist die Kasse zu prüfen. 3 Die Kassenaufsicht umfasst kein Weisungsrecht gegenüber dem Kassenpersonal.
#Abschnitt 2
Geschäftsgang
#§ 5
Kassenstunden
Die Öffnungszeiten der Kasse sind in geeigneter Weise bekanntzugeben.
#§ 6
Eingänge
(
1
)
Die Kassenleitung hat darauf zu achten, dass Postsendungen und dergleichen an die Kasse ungeöffnet weitergeleitet werden.
(
2
)
Wertsendungen sind von der Kassenleitung in Gegenwart einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters der Kasse zu öffnen und zu prüfen.
(
3
)
1 Eingehende Schecks (Verrechnungsschecks) sind wie Bargeld zu behandeln und zu vereinnahmen. 2 Sie sind unverzüglich zur Kontogutschrift beim Bankinstitut einzureichen.
(
4
)
Als Tag der Einzahlung gilt:
- bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln an die Kasse der Tag des Eingangs,
- bei Überweisungen auf ein Konto der Kasse der Tag, zu dem der Betrag gutgeschrieben worden ist.
§ 7
Kassenübergabe
(
1
)
Bei einem Wechsel der Kassenleitung ist eine Kassenbestandsaufnahme und möglichst eine Kassenprüfung vorzunehmen.
(
2
)
Bei der Kassenübergabe wirkt die für die Kassenaufsicht zuständige Person mit.
(
3
)
Über die Kassenübergabe wird eine Niederschrift angefertigt.
(
4
)
1 Ist die Kassenleitung vorübergehend (z.B. durch Urlaub, Krankheit, dienstliche Abwesenheit oder andere Gründe) an der Wahrnehmung dieser Funktion verhindert, werden die Kassengeschäfte von der Vertretung wahrgenommen. 2 Die Wahrnehmung ist jeweils im Tagesabschluss zu vermerken.
#Abschnitt 3
Geldverwaltung, Zahlungen
#§ 8
Konten
(
1
)
1 Die zuständige Stelle regelt, welche Konten unterhalten werden, und bestimmt einvernehmlich mit der Kassenleitung die Kontenbezeichnung und welche Mitarbeitenden in der Kasse Verfügungsberechtigung über die Konten erhalten. 2 Diese Befugnis kann mittels einer Vertretungsvollmacht delegiert werden.
(
2
)
Bestehende Girokonten der an der Kassengemeinschaft beteiligten kirchlichen Körperschaften sind aufzulösen beziehungsweise, sofern sie noch zwingend erforderlich sind, in Girokonten der Kasse umzuwandeln.
(
3
)
Die bestehenden Konten (einschließlich der Zahlstellen-Girokonten) sind in einer aktuellen Übersicht nachzuweisen.
#§ 9
Geldanlagen
(
1
)
1 Für die Liquiditätsplanung und -steuerung ist die Kassenleitung verantwortlich. 2 Für die Liquidität nicht benötigte Kassenmittel werden von der Stelle, die für die Geldanlage zuständig ist, angelegt.
(
2
)
1 Die zuständige Stelle bestimmt die für die übrigen Geldanlagen und für die Verwaltung des Kapitalvermögens nach §§ 56 und 57 HKRG zuständigen Mitarbeitenden, die damit zur Errichtung von Depots und Konten befugt werden. 2 Diese Befugnis kann mittels einer Vertretungsvollmacht delegiert werden.
#§ 10
Zahlungsverkehr
(
1
)
1 Überweisungsaufträge und Schecks sind von zwei Personen zu unterzeichnen. 2 Berechtigte Personen sind in geeigneter Weise bekannt zu machen.
(
2
)
Wird der Zahlungsverkehr elektronisch vorgenommen, haben die Verfügungsberechtigten die Zahlungsliste vor Freigabe an die Bank stichprobenartig zu prüfen und zu unterschreiben.
(
3
)
1 Aus Gründen der Kassensicherheit ist mit dem Geldinstitut zu vereinbaren, dass Abhebungen von Sparkonten nur über ein Referenzkonto der kassenführenden Stelle zulässig sind. 2 Andere Anlageformen sind ebenfalls nur über ein Referenzkonto der Kasse zu bewirtschaften.
(
4
)
Zahlungen sollen im elektronischen Überweisungsverfahren erfolgen.
(
5
)
1 Zahlungsmittel, die der Kasse oder der Zahlstelle übergeben werden, sind in Gegenwart der Einzahlenden auf ihre Echtheit, Vollzähligkeit und Vollständigkeit zu prüfen. 2 Als Zahlungsmittel soll die Währung EURO verwendet werden. 3 In begründeten Ausnahmefällen können Fremdwährungen angenommen werden. 4 Diese sind unverzüglich bei der Bank abzuliefern und bei Gutschrift des EURO-Betrages auf dem Konto zu buchen.
(
6
)
Das Ausstellen von Verrechnungsschecks ist unzulässig.
(
7
)
1 Das Führen von Kreditkarten und Bankkarten bedarf der Zustimmung der zuständigen Stelle. 2 Diese Befugnis kann mittels einer Vertretungsvollmacht delegiert werden.
(
8
)
1 Bei elektronischer Zahlung von Personalkosten dient die von der datenverarbeitenden Stelle (ZGAST) erstellte Zusammenstellung der Brutto-Personalkosten als Zahlungsliste. 2 Zwei hierzu berechtigte Mitarbeitende der Kasse haben darauf zu bescheinigen, dass der Gesamtbetrag gebucht und gezahlt wurde.
#§ 11
Barkasse
(
1
)
Die Barkasse ist Bestandteil der Kasse (Einheitskasse gem. § 38 Absatz 1 HKRG) und ausschließlich beim Träger der Kassengemeinschaft (§ 38 Absatz 2 HKRG) zu führen.
(
2
)
1 Der Barbestand ist so niedrig wie möglich zu halten. 2 Er darf den versicherten Betrag nicht übersteigen.
(
3
)
Die Kasse hat sich bei Barauszahlungen davon zu überzeugen, dass die abholende Person zum Empfang berechtigt ist.
(
4
)
1 Alle Zahlungsvorgänge (Ein- und Auszahlungen) eines Tages sind unverzüglich zu erfassen. 2 Das bei der Bank abgehobene Bargeld ist als Einzahlung, dass bei der Bank eingezahlte Bargeld als Auszahlung einzutragen.
(
5
)
1 Bei Beendigung der Kassenstunden der vorhandene Bargeld-Sollbestand zu ermitteln und mit dem Bargeld-Istbestand abzugleichen. 2 Ergibt der Soll-Ist-Vergleich einen Fehlbetrag oder Überschuss, ist dies unverzüglich der Kassenleitung zu melden.
(
6
)
1 Ein Wechsel in der Führung der Barkasse ist nachvollziehbar (unter Verwendung der Anlage 3) zu dokumentieren. 2 Ist die Übergabe durch den bisherigen Mitarbeitenden der Kasse nicht möglich, dokumentieren Kassenleitung und der neue Mitarbeitende der Kasse den Bestand der Barkasse.
#§ 12
Quittungen
(
1
)
1 Quittungen bei Einzahlungen sind mit einem handelsüblichen Durchschreibeblock zu erstellen. 2 Bei elektronischen Verfahren sind die hieraus generierten Quittungen zu verwenden. 3 Sie müssen enthalten:
- die einzahlende Person,
- die empfangsberechtigte Stelle,
- den Betrag in Zahlen,
- den Grund der Einzahlung,
- den Ort und den Tag der Einzahlung,
- die Bezeichnung der annehmenden Kasse ggf. mit Nennung der Zahlstelle,
- die Unterschrift (Empfangsbekenntnis).
(
2
)
Name und Unterschrift der berechtigten Mitarbeitenden der Kasse sind durch Aushang im Kassenraum bekannt zu machen.
#§ 13
Kassenanordnungen
(
1
)
1 Die in der Kasse eingehenden Kassenanordnungen sind unverzüglich mit dem Eingangsdatum zu versehen, sowie auf formelle Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. 2 Hat die Kasse gegen Form oder Inhalt einer Kassenanordnung Bedenken, richtet sich das Verfahren nach § 30 Absatz 12 HKRG und ist in der Kasse zu dokumentieren.
(
2
)
1 Nimmt die Kasse Einzahlungen an, für die keine Kassenanordnung vorliegt, so informiert sie die für die Bewirtschaftung zuständige Stelle. 2 Diese hat umgehend eine entsprechende Kassenanordnung an die Kasse zu leiten.
(
3
)
Enthält ein Rechnungsbeleg die Angaben nach § 30 Absatz 3 b), c), d) und g) HKRG, genügt anstelle des Vordrucks ein Stempelaufdruck (Anlage 1) auf dem Rechnungsbeleg, in welchem die übrigen Angaben des Absatzes 3 ergänzt werden (verkürzte Kassenanordnung).
(
4
)
1 Kassenanordnungen sind grundsätzlich elektronisch, die Anordnungs- und Feststellungsvermerke mit dokumentenechten Schreibmitteln oder in Form einer Fortgeschrittenen elektronischen Signatur (FES) zu erstellen. 2 Ergänzend zu den Vorgaben des § 30 Absatz 3 a) - k) und Absatz 5 HKRG und § 13 KassenVO müssen Kassenanordnungen enthalten:
- die Bezeichnung der Kasse,
- bei manueller Ausfertigung von Kassenanordnungen eine Wiederholung des Betrages in Worten, soweit die Wertgrenze des Bundesfinanzministeriums für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG, netto) überschritten wird,
- bei Auszahlungsanordnungen die zur Ausführung erforderlichen Angaben (Empfänger und IBAN bzw. Empfängernummer), soweit diese nicht aus den zahlungsbegründenden Unterlagen hervorgehen,
- die für den Zahlungsempfänger/-pflichtigen erforderlichen Informationen (Verwendungszweck),
- einen internen Buchungstext, welcher dazu geeignet ist, den eigentlichen Zahlungsgrund (ggf. unter Bezug auf einen vorhandenen Beschluss) ohne Akteneinsicht nachvollziehen zu können,
- bei Umbuchungen innerhalb der Kassengemeinschaft (interne Buchung zwischen mindestens zwei Haushaltsstellen) einen Buchungstext im Sinne von e) und Nennung der jeweils weiteren Haushaltsstelle(n).
(
5
)
1 Eine Einzelanordnung ist eine Kassenanordnung für einen Einzahlenden/Empfänger. 2 Eine Sammelanordnung ist eine Kassenanordnung für mehrere Einzahler/Empfänger, die sich auf die gleiche Haushaltsstelle bezieht.
(
6
)
1 Sind einer Kassenanordnung mehrere Haushaltsstellen zugeordnet, ist für jede Haushaltsstelle eine Ausfertigung zu erstellen. 2 Jede Ausfertigung ist mit Anordnungs- und Feststellungsvermerk zu versehen.
(
7
)
Für sich wiederholende im Vorfeld feststehende Leistungen sind für eine Haushaltsstelle Daueranordnungen (bei umsatzsteuerrelevanten Vorgängen „Wiederkehrende Belege“) zu erstellen.
(
8
)
Eine Allgemeine Kassenanordnung im Sinne von § 30 Absatz 7 HKRG muss enthalten:
- die Bezeichnung der Art der Einnahme/Ausgabe unter Angabe von entsprechenden Kennnummern (z.B. Veranstaltungsnummer, Lehrgang, Vertragsnummer),
- den Anordnungsvermerk und die sachliche Feststellung.
(
9
)
1 Soll die Berichtigung einzelner Angaben auf noch nicht ausgeführten Kassenanordnungen erfolgen, muss die Kassenanordnung mit einem Änderungsvermerk versehen werden, wobei die ursprünglichen Angaben lesbar bleiben müssen. 2 Die Änderungen sind von einem Anordnungs- und Feststellungsberechtigten mit entsprechenden Anordnungs- und Feststellungsvermerken zu versehen.
(
10
)
Soweit bereits gebuchte Zahlungen auf eine andere Haushaltsstelle übertragen werden sollen, ist der Kasse eine Umbuchungsanordnung zu erteilen.
(
11
)
1 Auszahlungsanordnungen sind der Kasse so rechtzeitig zuzuleiten, dass die Zahlung fristgerecht (auch für Skontoabzug) geleistet werden kann. 2 Liegen der Auszahlung
- Verträge,
- gerichtliche oder notarielle Anerkenntnisse oder
- sonstige Urkunden
zugrunde, so ist in der Auszahlungsanordnung darauf zu verweisen. 3 Bei Abschlagszahlungen ist anzugeben, ob es sich um die erste, zweite oder folgende Abschlagszahlung handelt. 4 Abtretungserklärungen sind beizufügen. 5 Beträge, die von Dritten an die Kasse zurückgezahlt werden, sind von der Ausgabe abzusetzen. 6 Rückzahlungen auf Ausgaben aus Vorjahren sind als Einnahmen zu behandeln.
(
12
)
1 Forderungen sind gegenüber dem Zahlungspflichtigen unter Angabe der Haushaltsstelle geltend zu machen. 2 Alle Forderungen, die im Laufe des Haushaltsjahres fällig werden, sind bei ihrer Entstehung anzuordnen. 3 Es darf nicht erst der Geldeingang abgewartet werden. 4 Beträge, die von der Kasse an Dritte zurückgezahlt werden, sind von der Einnahme abzusetzen. 5 Rückzahlungen auf Einnahmen aus Vorjahren sind als Ausgabe zu behandeln.
(
13
)
Zur Liquiditätssteuerung sowie zur Regulierung der Bargeldbestände ist die Kasse unverzüglich über hohe Einzahlungen und hohe Auszahlungen (bar, unbar) zu unterrichten, wenn diese seitens der Kasse festgelegte Wertgrenzen überschreiten.
(
14
)
1 Für Verwahrgelder, durchlaufende Gelder und Vorschüsse gelten die Regelungen entsprechend. 2 Bei Auszahlung von Vorschüssen ist möglichst gleichzeitig eine Annahmeanordnung über die erwartete Rückzahlung zu erstellen. 3 Die Abwicklung der Vorschuss- und Verwahrkonten hat unverzüglich zu erfolgen.
#§ 14
Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse
(
1
)
1 Die Anordnungsbefugnis wird von der zuständigen Stelle erteilt. 2 Diese Befugnis kann mittels einer Vertretungsvollmacht delegiert werden.
(
2
)
1 Für die der Aufsicht der Landeskirche unterstehenden kirchlichen Körperschaften werden Kassenanordnungen vom geschäftsführenden Mitglied der für die Ausführung des Haushaltes zuständigen Stelle angeordnet. 2 Bei seiner Verhinderung unterzeichnet derjenige Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende, der nicht geschäftsführendes Mitglied oder bevollmächtigte Mitglied ist. 3 In sachlich begründeten Fällen kann die zuständige Stelle eine auf den jeweiligen Arbeitsbereich begrenzte Anordnungsbefugnis durch Beschluss auch auf Diakone, Kirchenmusiker, Kindertagesstättenleitungen und deren ständige stellvertretenden Leitungen oder auf die für sie zuständigen Haushaltssachbearbeitenden in den Propsteiverbänden sowie deren Abwesenheitsvertretungen übertragen.
(
3
)
Mit der Unterschrift übernimmt der Anordnende die Verantwortung dafür, dass
- in der Kassenanordnung keine offensichtlich erkennbaren Fehler enthalten sind,
- die Feststellungsvermerke (sachliche und rechnerische Richtigkeit) von den dazu Befugten abgegeben worden sind und
- Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.
(
4
)
1 Die Feststellungsbefugnis wird von der zuständigen Stelle erteilt. 2 Diese Befugnis kann mittels einer Vertretungsvollmacht delegiert werden.
(
5
)
1 Die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit der für die Zahlung maßgeblichen Angaben ist auf der Kassenanordnung zu bescheinigen.
2 Mit der Feststellung der sachlichen Richtigkeit wird bestätigt, dass:
- die im Rechnungsbeleg enthaltenen tatsächlichen Angaben richtig sind,
- die Einnahme oder Ausgabe mit den geltenden Bestimmungen im Einklang steht und nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verfahren wurde und
- die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung oder Bestellung sachgemäß und vollständig ausgeführt worden ist.
(
6
)
Mit der Feststellung der rechnerischen Richtigkeit wird bestätigt, dass der zu buchende Betrag sowie alle auf Berechnungen beruhenden Angaben in der förmlichen Kassenanordnung, ihren Anlagen und in den begründenden Unterlagen richtig sind.
(
7
)
1 Ergänzend zur sachlichen Richtigkeit ist eine Feststellung der fachtechnischen Richtigkeit erforderlich, wenn besondere Fachkenntnisse erforderlich sind, um die technische oder fachliche Qualität einer Lieferung oder einer (Dienst-)Leistung beurteilen zu können (z.B. bei komplexen Bau-/Ingenieurleistungen, bei der Beschaffung von hochwertigem technischem Inventar oder bei spezialisierten Dienstleistungen). 2 Die fachtechnische Richtigkeit soll von der Person festgestellt werden, die für die Spezifikation (z.B. Leistungsbeschreibung) der Lieferung oder (Dienst-)Leistung verantwortlich war, die der Bestellung bzw. der Beauftragung zugrunde lag. 3 In Ausnahmefällen kann die Feststellung der fachtechnischen Richtigkeit durch eine andere Person getroffen werden, die über eine entsprechende Expertise verfügt. 4 Ein Verzicht auf die Feststellung der fachtechnischen Richtigkeit ist durch die anordnungsberechtigte Person in Textform beim Beleg zu dokumentieren, wenn der Wert der erbrachten Lieferung oder (Dienst-)Leistung über 10.000 EUR (brutto) liegt.
(
8
)
1 Bei der Ausübung der Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse müssen mindestens zwei befugte Personen zusammenwirken (Vier-Augen-Prinzip). 2 Die Feststellung der sachlichen Richtigkeit kann mit der Anordnung verbunden werden.
(
9
)
Anstelle der analogen Unterschriften können Fortgeschrittene elektronische Signaturen (FES) eingesetzt werden. Voraussetzung ist, dass diese eine EU-Konformität erfüllen und die Signaturen den jeweils unterzeichnenden Personen durch ein individuelles Zertifikat eindeutig zugeordnet werden können.
#§ 15
Fälligkeit, Zahlungserinnerung, Mahnung
(
1
)
Für die Überwachung der Fälligkeitstermine der angewiesenen Beträge ist die Kasse verantwortlich.
(
2
)
1 Ist ein Betrag zum Fälligkeitstermin nicht eingegangen, so wird dem Zahlungspflichtigen durch die Kasse (ggf. unter Einbeziehung der anordnenden Stelle) eine Zahlungserinnerung mit einer angemessenen Zahlungsfrist zugesandt. 2 Enthält die Kassenanordnung keinen Fälligkeitstermin, so erfolgt die Zahlungserinnerung vier Wochen nach Eingang der Kassenanordnung in der Kasse.
(
3
)
1 Erfolgt innerhalb der erneuten Zahlungsfrist nach Absatz 2 kein Zahlungseingang, ist der Zahlungspflichtige von der Kasse zu mahnen. 2 Mahngebühren können nach Maßgabe der Abgabenordnung (AO) erhoben werden. 3 Von Mahnungen von Beträgen unter 5,00 EUR soll abgesehen werden. 4 Gegebenenfalls ist die entsprechende Forderung niederzuschlagen.
(
4
)
1 Geht der Betrag nach einer angemessenen Frist nicht bei der Kasse ein, wird das gerichtliche Mahnverfahren bzw. Verwaltungszwangsverfahren eingeleitet. 2 Erscheint der Aufwand des Verfahrens im Verhältnis zum Betrag unverhältnismäßig, ist die anordnende Stelle einzubeziehen.
#Abschnitt 4
Zahlstellen
#§ 16
Einrichtung und Schließung von Zahlstellen
(
1
)
Zur Erledigung des örtlichen Zahlungsverkehrs können bei Bedarf Zahlstellen als Teil der Kasse der Kassengemeinschaft geführt werden.
(
2
)
1 Über die Einrichtung und Schließung von Zahlstellen entscheidet das Leitungsorgan des Trägers der Kassengemeinschaft. 2 Diese Befugnis kann innerhalb der Verwaltung delegiert werden. 3 Die Einrichtung ist schriftlich zu dokumentieren. 4 Die Kassenleitung und die für die Kassenaufsicht bestellte Person sind zu beteiligen.
(
3
)
Die Zahlstelle kann einen Bestand an Zahlungsmitteln als Vorschuss erhalten.
(
4
)
Eine Zahlstelle soll vom Träger der Kassengemeinschaft geschlossen werden, wenn eine Notwendigkeit für den Betrieb nicht mehr besteht.
(
5
)
1 Bei Schließung der Zahlstelle ist eine Kassenbestandsaufnahme durchzuführen und zu dokumentieren. 2 Der Saldo des Kassenbestandes ist unter Vorlage der Kassenbelege abzurechnen und auszugleichen.
#§ 17
Zahlstellenverwaltung
(
1
)
1 Die Kassenleitung bestellt eine Person zur Zahlstellenverwaltung sowie zur stellvertretenden Zahlstellenverwaltung. 2 Diese Person soll nicht bestellt werden, falls es Anhaltspunkte für die fachliche und/oder persönliche Nichteignung gibt. 3 Ist die Bestellung einer Vertretung nicht möglich, ist dies in der Niederschrift zur Errichtung der Zahlstelle zu begründen. 4 Bei Rechtsträgern, die einer kirchlichen Verwaltungsstelle angeschlossen sind, erfolgt die Bestellung auf Antrag des Rechtsträgers.
(
2
)
1 Eine Dienstanweisung für die Verwaltung von Zahlstellen ist nach einem verbindlichen Muster (Anlage 2) zu erlassen. 2 Die eingerichteten Zahlstellen sind in einem Bestandsverzeichnis beim Träger der Kassengemeinschaft nachzuweisen.
(
3
)
Bei jedem Wechsel der Zahlstellenverwaltung ist die Übergabe der Geschäfte durch eine Niederschrift nach einem verbindlichen Muster (Anlage 3) zu dokumentieren.
#§ 18
Aufgaben der Zahlstellen
1 Eine Zahlstelle ist als Bestandteil der Kasse ein ergänzendes Instrument des Zahlungsverkehrs für die festgelegten Zwecke. 2 Sie dient der nachrangigen Abwicklung von Barauszahlungen und Bareinzahlungen in Fällen, in denen eine Ausführung über die Kasse nicht zweckmäßig ist. 3 Einschränkungen (unzulässige Geschäftsvorgänge) sind im verbindlichen Muster der Dienstanweisung (Anlage 3) geregelt.
#§ 19
Führung der Bücher, Belege der Zahlstelle
(
1
)
Die Zahlstellenverwaltung erfasst alle Ein- und Auszahlungen nach der Zeitfolge unter Angabe der Haushaltsstelle unter Zuordnung der Belege.
(
2
)
An jedem Tag, an dem Ein- und Auszahlungen erfolgt sind, ist der Kassen-Sollbestand zu ermitteln und mit dem Kassen-Istbestand zu vergleichen (Kassenabstimmung).
#§ 20
Abrechnung der Zahlstelle mit der Kasse
(
1
)
1 Soweit bei der Einrichtung der Zahlstelle nichts Anderes festgelegt ist, wird die Zahlstelle monatlich mit der Kasse abgerechnet. 2 Der Abrechnung hat ein Zahlstellenabschluss unmittelbar vorauszugehen.
(
2
)
Die Zahlstellenverwaltung wird über die Finanzsoftware durchgeführt.
(
3
)
Die Zahlstellenabrechnung ist nach Abschluss von der Zahlstellenverwaltung zu unterzeichnen.
(
4
)
Der Zahlstellenabrechnung sind die jeweiligen Belege beizufügen.
#§ 21
Kassensicherheit bei Zahlstellen
(
1
)
Vollmacht und Bankkarte für das Girokonto der Kasse können die Zahlstellenverwaltung und die Vertretung erhalten.
(
2
)
Für die Verwaltung des Barbestandes der Zahlstelle gilt § 25 entsprechend.
#§ 22
Kassenprüfung bei Zahlstellen
(
1
)
1 Die Aufsicht über die Zahlstellen obliegt der Kassenleitung. 2 Eine Prüfung der Zahlstelle soll erfolgen, wenn
- Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten (z.B. Mängel in der Abwicklung, Entstehung von Fehlbeständen) bekannt werden,
- ein personeller Wechsel in der Zahlstellenverwaltung erfolgen soll.
(
2
)
Die unvermutete Prüfung einer Zahlstelle ist jederzeit möglich.
#Abschnitt 5
Kassensicherheit
#§ 23
Umsetzung der Kassensicherheit
(
1
)
Die Kassenleitung ist für die Kassensicherheit verantwortlich.
(
2
)
1 Die Zugriffs- und Benutzerrechte für die eingesetzte Finanzsoftware sind auf der Grundlage eines auf landeskirchlicher Ebene abgestimmten Rollenkonzepts zu organisieren und zu dokumentieren. 2 Der Umfang der Rechte (Zugriff auf Rechtsträger, freigeschaltete Funktionalitäten u.a.) ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. 3 Die Entscheidung über eine konkrete Zuordnung von Rollen auf Mitarbeitende obliegt auf Ebene der Träger der Kassengemeinschaften der Kassenaufsicht.
#§ 24
Schlüssel
(
1
)
1 Die Schlüssel, Zugangscodes und Ähnliches sind sicher vor unberechtigtem Zugriff zu verwahren. 2 Die Schlüsselberechtigung und -herausgabe ist zu dokumentieren (z.B. für Tresorschlüssel, Barkassenschlüssel, Dienstschlüssel, Duplikat-Schlüssel).
(
2
)
1 Der Verlust von Schlüsseln ist der Kassenleitung unverzüglich anzuzeigen. 2 Die Kassenleitung regelt im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle das Weitere und setzt die Kassenaufsicht in Kenntnis. 3 Diese Befugnis kann innerhalb der Verwaltung delegiert werden.
#§ 25
Zahlungsmittel und Wertgegenstände
(
1
)
1 Zahlungsmittel, Schecks, Sparbücher und sonstige Urkunden über Vermögenswerte und Ansprüche sind in einem geeigneten Kassenbehälter (z.B. Tresor, Stahlschrank) unter Verschluss zu nehmen. 2 Zahlungsmittel zur Erledigung der laufenden Kassengeschäfte sind von der mit der Führung der Barkasse bzw. Zahlstelle beauftragten Person in einem geeigneten, verschließbaren Behälter (Geldkassette) aufzubewahren. 4 Dieser Behälter ist nur während des einzelnen Zahlungsvorganges geöffnet zu halten. 5 Die versicherungstechnischen Wertgrenzen sind zu beachten.
(
2
)
1 Zahlungsmittel, Bank- und Bezahlkarten sowie Wertgegenstände, die nicht zum Bestand der Kasse gehören, dürfen nur mit schriftlicher Dokumentation und nur getrennt von den Beständen der Kassen in den unter Absatz 1 genannten Behältnissen aufbewahrt werden. 2 Hinsichtlich der Bank- und Bezahlkarten und der dazugehörigen PINs sind die Hinweise der ausgebenden Bank zur Aufbewahrung zu beachten.
(
3
)
Über die Annahme und Auslieferung der zu verwahrenden Gegenstände ist ein Nachweis zu führen.
#§ 26
Kassenbücher, Protokolle, Belege
(
1
)
1 Bücher nach § 46 HKRG sind gesichert aufzubewahren. 2 Die Bestimmungen des Datenschutzes sind einzuhalten.
(
2
)
1 Kassenbücher, Belege und Akten dürfen nur den mit Prüfungen Beauftragten ausgehändigt werden. 2 Anderen Personen ist die Einsicht in die Unterlagen nur zu gestatten, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird.
#§ 27
Geldbeförderung
Bei Geldtransporten sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:
- Beträge von mehr als 10.000 EUR sind von zwei geeigneten Personen zu befördern.
- Der zu befördernde Geldbetrag darf die Höhe des gegen Beraubung versicherten Wertes nicht übersteigen.
Abschnitt 6
Buchführung und Belege
#§ 28
Buchführung
(
1
)
1 Eingehende Buchungsbelege sind zeitnah, d.h. in der Regel am auf den Eingang folgenden Arbeitstag zu erfassen und zu buchen. 2 Die Belege sind mit einem Buchungsvermerk zu versehen. 3 Buchungsrückstände von mehr als drei Arbeitstagen sowie Kassendifferenzen, die nicht innerhalb von zwei Arbeitstagen aufgeklärt werden konnten, hat die Kassenleitung der Kassenaufsicht anzuzeigen.
(
2
)
Für wiederkehrende Ausgaben (z.B. öffentliche Abgaben) kann der Träger der Kassengemeinschaft Lastschriftmandate erteilen.
(
3
)
Grundsätzlich erfolgen alle Buchungen aufgrund von Kassenanordnungen, die den Vorschriften des HKRG entsprechen.
(
4
)
1 Ausnahmen sind die Vorgänge nach § 30 Absatz 11 HKRG. 2 Für diese werden interne Buchungsbelege erstellt.
#§ 29
Anlagenbuchhaltung
(
1
)
1 Aufgabe der Anlagenbuchhaltung ist es, Veränderungen des Sachanlagevermögens sowie der dazugehörigen Sonderposten buchhalterisch zu erfassen. 2 Hierzu gehören:
- Anlage und Pflege der Stammdaten der Anlagenbuchhaltung,
- Buchung der Belege (erstmalige Erfassung eines Anlagegutes),
- Buchung von Zu- und Abgängen des Sachanlagevermögens,
- Prüfung und Festlegung der Nutzungsdauer,
- Durchführung und Prüfung des Abschreibungslaufs und
- Abstimmung mit der Bilanzbuchhaltung, insbesondere Mitwirkung an den Jahresabschlussarbeiten.
(
2
)
Bei Erfassung von Buchungen in der Anlagenbuchhaltung sind auf dem buchungsbegründenden Beleg die Anlagennummern zu notieren.
#§ 30
Erfassungsunterlagen
(
1
)
Die Datenerfassung darf nur aufgrund ordnungsgemäßer Belege vorgenommen werden.
(
2
)
Kasseninterne Buchungsbelege, die gemäß des § 30 Absatz 11 HKRG ohne Kassenanordnung abgewickelt werden dürfen, müssen von zwei Mitarbeitenden der für die Aufgaben von Kasse und Buchhaltung zuständigen Organisationseinheit unterzeichnet werden.
#§ 31
Abstimmung
(
1
)
Alle unbaren zahlungswirksamen Buchungen sind anhand der Kassenanordnungen und der Erfassungsprotokolle von zwei Mitarbeitenden der für die Aufgaben von Kasse und Buchhaltung zuständigen Organisationseinheit auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen und durch Unterschrift auf dem Tagesabschluss sowie auf der im Anschluss erzeugten Zahlungsliste zu dokumentieren.
(
2
)
Die Abstimmung der Zahlwege erfolgt vor dem Tagesabschluss.
(
3
)
1 Die mit der Führung der Barkasse beauftragte Person hat diese bei Bestandsveränderungen am selben Tag abzustimmen und abzuschließen. 2 Die Abschlüsse sind der Kassenleitung zur Gegenzeichnung vorzulegen.
(
4
)
1 Bei der Übernahme von Daten aus vorgelagerten Verfahren bestätigt die mit dem Import betraute Person, dass der Saldo der automatisierten Buchungen mit der von der datenliefernden Stelle mitgeteilen Summe überstimmt. 2 Dies erfolgt durch Bestätigung und Unterschrift auf dem Zeitbuch des Tagesabschlusses, mit dem die Daten eingelesen wurden.
#§ 32
Ordnen der Belege
(
1
)
1 Die Belege mit zahlungsbegründender Unterlage sind grundsätzlich nach der Ordnung des Sachbuches in der Belegsammlung der jeweiligen Rechtsträger aufzubewahren. 2 Belege, die bei Zahlstellen erfasst werden, können davon abweichend zusammen mit der Zahlstellenabrechnung abgelegt werden. 3 Belege, die zu mehreren Buchungsstellen innerhalb eines Rechtsträgers gehören, sind bei der ersten Stelle einzuordnen. 4 Bei den weiteren Buchungsstellen ist ein entsprechender Hinweis aufzunehmen. 5 Die endgültige Aufbewahrungspflicht beim Rechtsträger nach Ende der Haushaltsperiode bleibt unberührt.
(
2
)
Geht ein Beleg verloren, wird ein Ersatzbeleg gefertigt, der als solcher zu kennzeichnen ist.
#Abschnitt 7
Schlussbestimmungen
#§ 33
Übergangsregelungen
Die Regelungen für Zahlstellen gemäß Abschnitt 4 sind unverzüglich anzuwenden.
#§ 34
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
1 Diese Kirchenverordnung tritt am 1. September 2025 in Kraft. 2 Gleichzeitig tritt die Kirchenverordnung über den Kassenbetrieb und den Zahlungsverkehr bei kirchlichen Körperschaften in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig (KassenVO) vom 2. November 2020 (ABl. 2021 S. 20) außer Kraft.
#Wolfenbüttel, den 20. August 2025
Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung
Kirchenregierung
Dr. Mayer
Oberlandeskirchenrat
#Oberlandeskirchenrat
Anlage 1 - Stempelvordruck für verkürzte Kassenanordnungen gemäß § 13 Absatz 3
Anlage 2 - Dienstanweisung für die Zahlstellenverwaltung gemäß § 17 Absatz 2
Anlage 3 - Niederschrift über den Wechsel einer Zahlstellenverwaltung gemäß § 17 Absatz 3
Nr. 48Kirchenverordnung
zur Durchführung und Ergänzung datenschutzrechtlicher Vorschriften (Datenschutzdurchführungsverordnung – DATVO)
(RS 953)
zur Durchführung und Ergänzung datenschutzrechtlicher Vorschriften (Datenschutzdurchführungsverordnung – DATVO)
(RS 953)
In der Neufassung vom 20. August 2025
Aufgrund von § 9 des Kirchengesetzes zur Ergänzung und Durchführung des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (Datenschutz-Anwendungsgesetz – DSAG) vom 23. November 2018 (ABl. 2019 S. 4) wird verordnet:
#Präambel
Die Gliedkirchen der Konföderation haben mit ihren Datenschutzanwendungsgesetzen gemäß § 54 EKD-Datenschutzgesetz (DSG-EKD) jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich landeskirchenspezifische Bestimmungen zur Durchführung und Anwendung des DSG-EKD geschaffen.
Diese Kirchenverordnung auf Grundlage des Datenschutz-Anwendungsgesetzes ergänzt und konkretisiert die Bestimmungen des DSG-EKD und soll eine einheitliche Anwendung der datenschutzrechtlichen Grundsätze innerhalb der Gliedkirchen der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen sicherstellen.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist rechtswidrig, soweit sie nicht von einem gesetzlichen Erlaubnistatbestand gedeckt ist (Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt).
###§ 1
Aufgaben verantwortlicher Stellen
Die kirchlichen Körperschaften und die übrigen kirchlichen Stellen verarbeiten Daten im Rahmen ihrer durch das kirchliche Recht bestimmten oder herkömmlichen Aufgabenbereiche, insbesondere der Verkündigung, Seelsorge, Diakonie, Mission und Unterweisung, Fundraising, Finanzverwaltung, Melde- und Friedhofswesen, Kindertagesstätten und der übrigen Aufgaben der Verwaltung in kirchlichen Körperschaften, Behörden und Dienststellen sowie in kirchlichen Werken und Einrichtungen ohne Rücksicht auf deren Rechtsform.
#§ 2
Kirchenbuchwesen und Meldewesen
(
1
)
1 Daten von Kirchenmitgliedern aus dem Kirchenbuchwesen und der Kirchgeldhebung dürfen mit Meldewesendaten wechselseitig verknüpft werden. 2 Insbesondere dürfen die Angaben über kirchlich beurkundete Amtshandlungen für Einladungen zu Jubiläen dieser Amtshandlungen, zur Erinnerung an die Taufe und zu anderen kirchlichen Veranstaltungen verarbeitet werden. 3 Widersprüche sind aufzunehmen und zu beachten.
(
2
)
1 Kirchenbuchdaten und Daten aus dem kirchlichen Meldewesen dürfen verarbeitet werden, um Kirchenmitglieder zur Taufe ihrer noch ungetauften Kinder einzuladen. 2 Widersprüche sind aufzunehmen und zu beachten.
#§ 3
Veröffentlichung von Gemeindegliederdaten und Amtshandlungsdaten
(
1
)
1 Die Kirchengemeinden dürfen Alters- und Ehejubiläen von Gemeindegliedern in Gemeindebriefen und anderen örtlichen kirchlichen Publikationen mit Namen sowie Tag und Ort des Ereignisses veröffentlichen, soweit die Betroffenen im Einzelfall nicht widersprochen haben. 2 Auf das Widerspruchsrecht sind die Betroffenen rechtzeitig vor der Veröffentlichung hinzuweisen. 3 Bei regelmäßigen Veröffentlichungen ist es ausreichend, wenn ein Hinweis auf das Widerspruchsrecht regelmäßig an derselben Stelle wie die Veröffentlichung erfolgt.
(
2
)
1 Die Kirchengemeinden dürfen Amtshandlungen in Gottesdiensten bekannt geben und in Gemeindebriefen und anderen örtlichen kirchlichen Publikationen mit Namen sowie Tag und Ort der Amtshandlung veröffentlichen sowie Auskünfte zu Amtshandlungen erteilen. 2 In Gottesdiensten und Gemeindebriefen dürfen zusätzlich Geburts- und Sterbedatum sowie Lebensalter von verstorbenen und kirchlich bestatteten Personen bekannt gegeben werden. 3 Die Bekanntgabe, Veröffentlichung und Auskunft unterbleiben, wenn hierfür von den Betroffenen ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der Veröffentlichung geltend gemacht wird.
(
3
)
1 Die aus den kommunalen Melderegistern übermittelten Auskunfts- und Übermittlungssperren sowie Widersprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind in die kirchlichen Gemeindegliederverzeichnisse aufzunehmen und zu beachten. 2 Personenbezogene Daten von Personen, für die Auskunftssperren nach § 51 Bundesmeldegesetz (BMG), ein bedingter Sperrvermerk nach § 52 BMG oder Maßnahmen des Zeugenschutzes nach § 53 BMG bestehen, dürfen für Veröffentlichungen nur genutzt werden, wenn vorher das Einverständnis der betroffenen Personen in Textform eingeholt wurde. 3 Dies gilt auch für die Familienangehörigen der betroffenen Personen.
(
4
)
Die Veröffentlichung von Namen von Gemeindegliedern, ihrer Alters- und Ehejubiläen sowie von kirchlichen Amtshandlungsdaten im Internet ist nur zulässig, wenn die Einwilligung der betroffenen Personen vorher in Textform eingeholt wurde.
#§ 4
Friedhöfe
(
1
)
Die Lage von Grabstätten darf Dritten auf entsprechende Nachfrage bekannt gegeben werden, wenn diese ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen und anzunehmen ist, dass schutzwürdige Belange der Verstorbenen und der Nutzungsberechtigten nicht beeinträchtigt werden.
(
2
)
Zum Gedenken und zur Fürbitte dürfen in Sterbe- oder Totenbücher, die in Kirchen oder sonstigen kirchlichen Gebäuden allgemein zugänglich sind, Namen und Vornamen der verstorbenen Personen sowie Geburts- und Sterbedaten eingetragen werden.
#§ 5
Fundraising
(
1
)
Fundraising als kirchliche Aufgabe wahrgenommen, verbindet die Beziehungspflege mit dem Werben um persönlichen und finanziellen Einsatz für kirchliche und diakonische Zwecke.
(
2
)
Kirchliche Stellen dürfen personenbezogene Daten von Gemeindegliedern und deren Angehörigen, von den in der kirchlichen oder in der diakonischen Arbeit ehrenamtlich oder beruflich Tätigen und von an der kirchlichen und diakonischen Arbeit interessierten Personen für das Fundraising verarbeiten, soweit dies für die Durchführung des Fundraisings erforderlich ist.
(
3
)
Die kirchlichen Stellen dürfen für das Fundraising ihre im Gemeindegliederverzeichnis und in den Kirchenbüchern enthaltenen Daten von Kirchenmitgliedern und Familienangehörigen nutzen, soweit kein melderechtlicher Sperrvermerk diese Nutzung ausschließt.
(
4
)
Kirchliche Stellen dürfen für das Fundraising Daten nutzen, die aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen oder zu diesem Zweck erworben werden.
(
5
)
Personenbezogene Daten der von diakonischen Einrichtungen betreuten oder behandelten Personen (Patientendaten), ihrer Angehörigen, Bevollmächtigten sowie ihrer rechtlichen Betreuer und Betreuerinnen dürfen nur mit deren Einwilligung verarbeitet werden.
(
6
)
Die für das Fundraising erhobenen personenbezogenen Daten sind zu löschen, soweit der Löschung ein konkreter kirchlicher Auftrag, Rechtsvorschriften oder Aufbewahrungsfristen nicht entgegenstehen.
(
7
)
Personenbezogene Daten können an kirchliche Stellen offengelegt werden, wenn
- die empfangende kirchliche Stelle sie ausschließlich für das eigene Fundraising nutzt,
- die empfangende kirchliche Stelle sicherstellt, dass der Umfang und der Zeitpunkt des Fundraisings mit der übermittelnden kirchlichen Stelle abgestimmt werden,
- die datenempfangende kirchliche Stelle sicherstellt, dass Widersprüche von betroffenen Personen gegen die Datennutzung im Rahmen des Fundraisings beachtet und der übermittelnden kirchlichen Stelle mitgeteilt werden und
- ausreichende technische und organisatorische Datenschutzmaßnahmen unter Beachtung des Schutzbedarfs der Anforderungen gemäß § 27 DSG-EKD vorliegen, von denen sich die übermittelnde kirchliche Stelle im Zweifelsfall zu überzeugen hat.
(
8
)
Für das Fundraising kirchlicher Stellen dürfen nur folgende Daten von Kirchenmitgliedern und ihren Familienangehörigen aus dem kirchlichen Meldewesen verarbeitet werden:
- Name, Vorname und gegenwärtige Anschrift,
- Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit(en), Familienstand, Stellung in der Familie,
- Zahl und Alter der minderjährigen Kinder,
- Religionszugehörigkeit und Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde.
(
9
)
1 Weitere Daten von Kirchenmitgliedern dürfen von den zuständigen kirchlichen Stellen für das Fundraising verarbeitet werden, soweit dies für die Durchführung der Maßnahme erforderlich ist, insbesondere:
- Name, Vorname und Anschrift von Spenderinnen und Spendern, zugehörige Kirchengemeinde,
- Art, Betrag, Zweck und Zeitpunkt der geleisteten Spenden,
- Erteilung von Zuwendungsbestätigungen,
- Daten des Kontaktes,
- Daten der erforderlichen Buchhaltung,
- Daten zur statistischen analytischen Auswertung.
2 Entsprechendes gilt für Personen, die mit der kirchlichen und diakonischen Arbeit in Beziehung getreten sind.
(
10
)
Spenden anlässlich von Jubiläen, Geburtstagen und Trauerfällen, die auf Veranlassung der Jubilarin oder des Jubilars sowie von Familienangehörigen für einen kirchlichen Zweck gesammelt werden, dürfen der veranlassenden Person mit Namen und Spendenhöhe bekannt gegeben werden.
(
11
)
Es ist sicherzustellen, dass Personen, die den Erhalt von Spendenaufrufen ausdrücklich nicht wünschen oder diesem widersprochen haben, von der Durchführung des Fundraisings nach Absatz 1 bis 10 ausgenommen werden.
#§ 6
Wahl zu kirchlichen Leitungsämtern und Organen
1 Personenbezogene Daten der Kandidaten und Kandidatinnen für durch Wahl zu besetzende kirchliche Leitungsämter und für Sitze in kirchlichen Leitungsorganen dürfen für die öffentliche Bekanntgabe in folgendem Umfang verarbeitet werden: Name, Vorname, akademischer Grad, Anschrift, Beruf und Lebensalter. 2 Die öffentliche Bekanntgabe kann durch andere Arten der Bekanntmachung ergänzt werden.
#§ 7
Kirchliches Amtsblatt
1 Im Kirchlichen Amtsblatt dürfen folgende Personalnachrichten der Pfarrer und Pfarrerinnen, Kandidaten und Kandidatinnen der Theologie, Vikare und Vikarinnen, Pfarrer und Pfarrerinnen im Ehrenamt, Prediger und Predigerinnen im Ehrenamt sowie der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in Leitungsämtern mit Datum veröffentlicht werden, auch soweit das Kirchliche Amtsblatt im Internet veröffentlicht wird:
- Name und die Tatsache der bestandenen ersten oder zweiten theologischen Prüfung, Ordination sowie deren Aberkennung, Ernennung, Berufung, Besetzung (§ 47 Kirchenverfassung), Abberufung, Beendigung, Ausscheiden (aus dem Dienst), Ruhestand;
- im Zusammenhang mit dem Versterben auch das Geburts- und Sterbedatum, Tätigkeitsorte, Aufgaben und Ämter sowie Beginn des Ruhestands.
2 Entsprechendes gilt für die Personalnachrichten von Mitgliedern kirchlicher Leitungsorgane.
#§ 8
Einheitliche Datenverwaltungssysteme, Intranet
Personenbezogene Daten aus den Bereichen Ausbildungs-, Prüfungs-, Personal-, Stellen-, Gremien-, Finanz- und Liegenschaftsverwaltung, aus diakonischen Arbeitsbereichen und sonstigen kirchlichen Bereichen sowie Anschriftenverzeichnisse und digitale Adressbücher dürfen, soweit dies aus organisatorischen Gründen erforderlich ist, im Rahmen eines einheitlichen Datenverwaltungsprogramms verarbeitet werden.
#§ 9
Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendhilfe
1 Kirchliche Stellen als Träger von Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Jugendhilfe dürfen personenbezogene Daten der Kinder und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten für Zwecke der eigenen Kirchengemeindearbeit verarbeiten. 2 Eine Übermittlung zu diesen Zwecken an die örtliche Kirchengemeinde ist zulässig, soweit die Trägerschaft übergemeindlich verortet ist und es sich bei dem Träger der Einrichtung um eine andere kirchliche Stelle handelt.
#§ 10
Sozialdatenschutz
Nehmen kirchliche Stellen Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch wahr, gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten die Regelungen über den Sozialdatenschutz der jeweiligen Teile des Sozialgesetzbuchs entsprechend.
#§ 11
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
1 Diese Kirchenverordnung tritt am 1. September 2025 in Kraft.
2 Gleichzeitig tritt die Kirchenverordnung zur Durchführung und Ergänzung datenschutzrechtlicher Vorschriften (Datenschutzdurchführungsverordnung - DATVO) vom 21. März 2019 (ABl. 2019 S. 55); zuletzt geändert am 15. Januar 2025 (ABl. 2025 Nr. 31) außer Kraft.
#Wolfenbüttel, den 20. August 2025
Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung
Kirchenregierung
Dr. Mayer
Oberlandeskirchenrat
stellvertretender Vorsitzender
Oberlandeskirchenrat
stellvertretender Vorsitzender
Beschlüsse
Nr. 49Bekanntmachung
des Beschlusses der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die
109. Änderung der Dienstvertragsordnung
(RS 461)
des Beschlusses der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die
109. Änderung der Dienstvertragsordnung
(RS 461)
Im Kirchlichen Amtsblatt Hannovers 1/2025 ist ab Seite 3 der Beschluss der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die 109. Änderung der Dienstvertragsordnung bekannt gemacht worden. Dies wird hiermit zur Kenntnis gegeben.
Wolfenbüttel, den 11. August 2025
Landeskirchenamt
Bönsch
Oberlandeskirchenrätin
Oberlandeskirchenrätin
Bekanntmachung
des Beschlusses der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die
109. Änderung der Dienstvertragsordnung
Hannover, den 13. Januar 2025
Nachstehend geben wir den Beschluss der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission vom 13. Juni 2024 über die 109. Änderung der Dienstvertragsordnung bekannt.
Konföderation
evangelischer Kirchen
in Niedersachsen
evangelischer Kirchen
in Niedersachsen
- Geschäftsstelle -
Dr. Gäfgen-Track
##Dr. Gäfgen-Track
109. Änderung der Dienstvertragsordnung
Vom 13. Juni 2024
Aufgrund des § 14 Absatz 2 des Kirchengesetzes über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im kirchlichen Dienst (Arbeitsrechtsregelungsgesetz - ARRG-Kirche) vom 12. Dezember 2017 (KABl. Hannover 2017 S. 156) hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission die Dienstvertragsordnung vom 16. Mai 1983 in der Fassung der Bekanntmachung der 61. Änderung vom 10. Juni 2008 (KABl. Hannover 2008 S. 70), zuletzt geändert durch die 108. Änderung der Dienstvertragsordnung vom 26. Januar 2024 (KABl. Hannover 2024 S. 95), wie folgt geändert:
##§ 1
Änderung der Dienstvertragsordnung
Die Anlage 2 (zu §§ 15, 15a) der Entgeltordnung zur Dienstvertragsordnung, Abschnitt B, erhält folgende Fassung:
„B. Sekretärinnen im Landeskirchenamt in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig
Entgeltgruppe 8
1. Sekretärinnen der Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen im Landeskirchenamt Wolfenbüttel
Entgeltgruppe 9a
2. Sekretärinnen des Landesbischofs oder der Landesbischöfin“.
#§ 2
Überleitungsregelungen
(
1
)
1 Für die Mitarbeiterinnen der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg und der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, deren Tätigkeitsmerkmale bisher in dem Abschnitt B geregelt waren, finden die folgenden Überleitungsregelungen Anwendung. 2 Bestehen die Dienstverhältnisse der genannten Mitarbeiterinnen über den 31. Dezember 2024 hinaus fort, gilt ab dem 1. Januar 2025 für Eingruppierungen die Anlage A zum TV-L Teil I (Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungsdienst). 3 Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zum 1. Januar 2025 nach den nachfolgenden Regelungen in die Anlage A zum TV-L Teil I übergeleitet.
(
2
)
1 Die Mitarbeiterinnen sind unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit zum 1. Januar 2025 in die Anlage A zum TV-L Teil I übergeleitet. 2 Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierungen findet aufgrund der Überleitung in die Anlage A zum TV-L Teil I nicht statt. 3 Eine bisher gewährte Funktionszulage wird für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit unverändert weitergezahlt.
(
3
)
1 Ergibt sich nach der Anlage A zum TV-L Teil I eine höhere Entgeltgruppe, sind die Mitarbeiterinnen auf Antrag in die Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach § 12 TV-L ergibt. 2 Die Stufenzuordnung in der höheren Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für Höhergruppierungen (§ 17 Absatz 4 TV-L). 3 Eine Besitzstandszulage nach § 11 ARR-Ü-Konf bleibt unberührt.
(
4
)
Fallen am 1. Januar 2025 ein Stufenaufstieg und die Höhergruppierung nach Absatz 1 zusammen, erfolgt erst der Stufenaufstieg und anschließend die Höhergruppierung.
(
5
)
1 Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 kann nur bis zum 31. Dezember 2025 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. Januar 2025 zurück. 2 Nach dem Inkrafttreten dieser Änderung der Dienstvertragsordnung eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach Absatz 3 Sätze 2 und 3 unberücksichtigt. 3 Ruht das Dienstverhältnis am 1. Januar 2025, beginnt die Frist von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2025 zurück.
#§ 3
Inkrafttreten
Diese Änderung der Dienstvertragsordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.
#Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission
Fricke
Vorsitzender
Vorsitzender
Nr. 50Bekanntmachung
des Beschlusses der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die
110. Änderung der Dienstvertragsordnung
(RS 461)
des Beschlusses der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die
110. Änderung der Dienstvertragsordnung
(RS 461)
Im Kirchlichen Amtsblatt Hannovers 1/2025 ist ab Seite 4 der Beschluss der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die 110. Änderung der Dienstvertragsordnung bekannt gemacht worden. Dies wird hiermit zur Kenntnis gegeben.
Wolfenbüttel, den 11. August 2025
Landeskirchenamt
Bönsch
Oberlandeskirchenrätin
Oberlandeskirchenrätin
Bekanntmachung
des Beschlusses der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die
110. Änderung der Dienstvertragsordnung
Hannover, den 10. Dezember 2024
Nachstehend geben wir den Beschluss der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission vom 13. Juni 2024 über die 110. Änderung der Dienstvertragsordnung bekannt.
Konföderation
evangelischer Kirchen
in Niedersachsen
evangelischer Kirchen
in Niedersachsen
- Geschäftsstelle -
Dr. Gäfgen-Track
##Dr. Gäfgen-Track
110. Änderung der Dienstvertragsordnung
Vom 13. Juni 2024
Aufgrund des § 14 Absatz 2 des Kirchengesetzes über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im kirchlichen Dienst (Arbeitsrechtsregelungsgesetz - ARRG-Kirche) vom 12. Dezember 2017 (KABl. Hannover 2017 S. 156) hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission die Dienstvertragsordnung vom 16. Mai 1983 in der Fassung der Bekanntmachung der 61. Änderung vom 10. Juni 2008 (KABl. Hannover 2008 S. 70), zuletzt geändert durch die 109. Änderung der Dienstvertragsordnung vom 13. Juni 2024 (KABl. Hannover 2025 S. 3), wie folgt geändert:
##§ 1
Änderung der Dienstvertragsordnung
In der Anlage 2 wird nach dem Abschnitt P folgender Abschnitt Q angefügt:
„Q Interprofessionelle Teams in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg1
Entgeltgruppe 10
- 1.
- Mitarbeiterinnen mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium oder Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvoraussetzungen erfüllen, deren Tätigkeit im Interprofessionellen Team gründliche, umfassende Fachkenntnisse und selbständige Leistungen erfordert.
Entgeltgruppe 11
- 2.
- Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1 mit Prädikantinnen- oder Seelsorgeausbildung, denen mindestens zu einem Drittel pfarramtliche Aufgaben nach Artikel 34 Satz 1 Kirchenordnung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg übertragen sind.2
Entgeltgruppe 12
- 3.
- Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 2, denen überwiegend pfarramtliche Aufgaben nach Artikel 34 Satz 1 Kirchenordnung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg übertragen sind.2
Entgeltgruppe 13
- 4.
- Mitarbeiterinnen mit einer ihrer Tätigkeit entsprechenden abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulbildung mit Prädikantinnen- oder Seelsorgeausbildung, die mit der Verwaltung einer Pfarrstelle beauftragt sind.2
Anmerkungen:
1 Kirchengesetz zur Erprobung und Entwicklung Interprofessioneller Teams in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.
2 Über das Vorliegen einer entsprechenden Ausbildung entscheidet die oberste Dienstbehörde.“
#§ 2
Inkrafttreten
Diese Änderung der Dienstvertragsordnung tritt am 1. Oktober 2024 in Kraft.
#Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission
Fricke
Vorsitzender
Vorsitzender
Nr. 51Bekanntmachung
des Beschlusses der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die
111. Änderung der Dienstvertragsordnung sowie die
16. Änderung der Arbeitsrechtsregelung
zur Überleitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und
zur Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü-Konf) sowie die
13. Änderung der Arbeitsrechtsregelung
für Auszubildende und Praktikantinnen (ARR-Azubi/Prakt)
(RS 461, 461.1, 496)
des Beschlusses der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die
111. Änderung der Dienstvertragsordnung sowie die
16. Änderung der Arbeitsrechtsregelung
zur Überleitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und
zur Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü-Konf) sowie die
13. Änderung der Arbeitsrechtsregelung
für Auszubildende und Praktikantinnen (ARR-Azubi/Prakt)
(RS 461, 461.1, 496)
Im Kirchlichen Amtsblatt Hannovers 1/2025 ist ab Seite 14 der Beschluss der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die 111. Änderung der Dienstvertragsordnung sowie die 16. Änderung der Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zur Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü-Konf) sowie die 13. Änderung der Arbeitsrechtsregelung für Auszubildende und Praktikantinnen (ARR-Azubi/Prakt) bekannt gemacht worden. Dies wird hiermit zur Kenntnis gegeben.
Wolfenbüttel, den 11. August 2025
Landeskirchenamt
Bönsch
Oberlandeskirchenrätin
Oberlandeskirchenrätin
Bekanntmachung
des Beschlusses der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die
111. Änderung der Dienstvertragsordnung
Hannover, den 10. Dezember 2024
Nachstehend geben wir den Beschluss der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission vom 4. Dezember 2024 über die 111. Änderung der Dienstvertragsordnung bekannt.
Konföderation
evangelischer Kirchen
in Niedersachsen
evangelischer Kirchen
in Niedersachsen
- Geschäftsstelle -
Dr. Gäfgen-Track
##Dr. Gäfgen-Track
111. Änderung der Dienstvertragsordnung
Vom 4. Dezember 2024
Aufgrund des § 14 Absatz 2 des Kirchengesetzes über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im kirchlichen Dienst (Arbeitsrechtsregelungsgesetz - ARRG-Kirche) vom 12. Dezember 2017 (KABl. Hannover 2017 S. 156) hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission die Dienstvertragsordnung vom 16. Mai 1983 in der Fassung der Bekanntmachung der 61. Änderung vom 10. Juni 2008 (KABl. Hannover 2008 S. 70), zuletzt geändert durch die 110. Änderung der Dienstvertragsordnung vom 13. Juni 2024 (KABl. Hannover 2025 S. 4), wie folgt geändert:
##Artikel 1
- Die Anlage 1 wird wie folgt geändert:
- Nach Nummer 1.11.2 wird folgende Nummer 1.12 eingefügt:„1.12 § 1 Nummer 1 und 6 des Änderungstarifvertrages Nr. 13 zum TV-L vom 9. Dezember 2023 (KABl. Hannover 2025 S. 50)”.
- Nach Nummer 2.8 wird folgende Nummer 2.9 eingefügt:„2.9 Änderungstarifvertrag Nr. 9 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) vom 9. Dezember 2023 mit Ausnahme des § 2 (KABl. Hannover 2025 S. 55)”.
Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Änderung der Dienstvertragsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2023 in Kraft.
#16. Änderung der Arbeitsrechtsregelung
zur Überleitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und
zur Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü-Konf)
Vom 4. Dezember 2024
Aufgrund des § 14 Absatz 2 des Kirchengesetzes über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im kirchlichen Dienst (Arbeitsrechtsregelungsgesetz - ARRG-Kirche) vom 12. Dezember 2017 (KABl. Hannover 2017 S. 156) hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission die Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen und der beteiligten Kirchen aufgrund der 61. Änderung der Dienstvertragsordnung vom 10. Juni 2008 und zur Regelung des Übergangsrechts vom 10. Juni 2008 - ARR-Ü-Konf - (KABl. Hannover 2008 S. 70), die zuletzt durch die 15. Änderung der Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zur Regelung des Übergangsrechts vom 8. September 2022 (KABl. Hannover 2022 S. 76, 77) geändert worden ist, wie folgt geändert:
#Artikel 1
Änderung der ARR-Ü-Konf
- Die Anmerkung zu § 9 Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung:„Die Besitzstandszulage erhöht sich ab 1. November 2024 um 4,76 v. H. und ab 1. Februar 2025 um 5,5 v. H.”
- § 17 wird wie folgt geändert:
- Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:„ 2 Die besonderen Tabellenwerte betragen
- in der Zeit vom 1. Oktober 2023 bis 31. Oktober 2024Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 62.369,862.577,932.657,482.755,412.822,722.914,51
- in der Zeit vom 1. November 2024 bis 31. Januar 2025Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 62.569,862.777,932.857,482.955,413.022,723.114,51
- ab 1. Februar 2025Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 62.711,202.930,723.014,643.117,963.188,973.285,81“
Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„Für Mitarbeiterinnen, die in die Entgeltgruppe 13 Ü übergeleitet worden sind, gelten folgende Tabellenwerte:
- in der Zeit vom 1. Oktober 2023 bis 31. Oktober 2024Stufe 2Stufe 3Stufe 4aStufe 4bStufe 5Stufe 6Nach 2 Jahren in
Stufe 2Nach 4 Jahren in
Stufe 3Nach 3 Jahren in
Stufe 4aNach 3 Jahren in
Stufe 4bNach 5 Jahren in
Stufe 5Beträge aus(E 13/2)(E 13/3)(E 14/3)(E 14/4)(E 14/5)(E 14/6)E 13 Ü4.508,074.748,545.167,635.593,596.246,276.433,67
in der Zeit vom 1. November 2024 bis 31. Januar 2025
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4a | Stufe 4b | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Nach 2 Jahren in Stufe 2 | Nach 4 Jahren in Stufe 3 | Nach 3 Jahren in Stufe 4a | Nach 3 Jahren in Stufe 4b | Nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
Beträge aus | (E 13/2) | (E 13/3) | (E 14/3) | (E 14/4) | (E 14/5) | (E 14/6) |
E 13 Ü | 4.708,07 | 4.948,54 | 5.367,63 | 5.793,59 | 6.446,27 | 6.633,67 |
ab 1. Februar 2025
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4a | Stufe 4b | Stufe 5 | Stufe 6 | |
Nach 2 Jahren in Stufe 2 | Nach 4 Jahren in Stufe 3 | Nach 3 Jahren in Stufe 4a | Nach 3 Jahren in Stufe 4b | Nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
Beträge aus | (E 13/2) | (E 13/3) | (E 14/3) | (E 14/4) | (E 14/5) | (E 14/6) |
E 13 Ü | 4.967,01 | 5.220,71 | 5.662,85 | 6.112,24 | 6.800,81 | 6.998,52“ |
Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„ 3 Für sie gelten folgende Tabellenwerte:
- vom 1. Oktober 2023 bis 31. Oktober 2024Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 56.122,636.795,907.434,887.853,957.957,04
- in der Zeit vom 1. November 2024 bis 31. Januar 2025Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 56.322,636.995,907.634,888.053,958.157,04
ab 1. Februar 2025
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
6.670,37 | 7.380,67 | 8.054,80 | 8.496,92 | 8.605,68“ |
Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Änderung Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zur Regelung des Übergangsrechts tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2023 in Kraft.
#13. Änderung der Arbeitsrechtsregelung
für Auszubildende und Praktikantinnen (ARR-Azubi/Prakt)
Vom 4. Dezember 2024
Aufgrund des § 14 Absatz 2 des Kirchengesetzes über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im kirchlichen Dienst (Arbeitsrechtsregelungsgesetz - ARRG-Kirche) vom 12. Dezember 2017 (KABl. Hannover 2017 S. 156) hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission die Arbeitsrechtsregelung für Auszubildende und Praktikantinnen vom 10. Juni 2008 - ARR-Azubi/Prakt - (KABl. Hannover 2008 S. 70), die zuletzt durch die 12. Änderung der Arbeitsrechtsregelung für Auszubildende und Praktikantinnen vom 20. September 2023 (KABl. Hannover 2023 S. 99) geändert worden ist, wie folgt geändert:
#Artikel 1
Änderung der ARR-Azubi/Prakt
- Anlage 1 wird wie folgt geändert:
- Nach der Nummer 11 wird folgende Nummer 12 angefügt:„12. Änderungstarifvertrag Nr. 12 zum Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG) vom 9. Dezember 2023 mit Ausnahme des § 2 (KABl. Hannover 2025 S. 58)”.
- Anlage 2 wird wie folgt geändert:
- Nach der Nummer 11 wird folgende Nummer 12 angefügt:„12. Änderungstarifvertrag Nr. 12 zum Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen (TVA-L Pflege) vom 9. Dezember 2023 mit Ausnahme des § 2 (KABl. Hannover 2025 S. 59)”.
- Anlage 3 wird wie folgt geändert:
- Nach der Nummer 6 folgende Nummer 7 angefügt:„7. Änderungstarifvertrag Nr. 7 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten der Länder (TV Prakt-L) vom 9. Dezember 2023 mit Ausnahme des § 1 Nummer 3 und des § 2 (KABl. Hannover 2025 S. 60)”.
Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Änderung der Arbeitsrechtsregelung für Auszubildende und Praktikantinnen tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2023 in Kraft.
#Hannover, den 4. Dezember 2024
Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission
Fricke
Vorsitzender
Vorsitzender
Nr. 52Bekanntmachung
des Beschlusses der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die Arbeitsrechtsregelung über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (ARR-Inflationsausgleich TV-L)
(RS 461.2)
des Beschlusses der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die Arbeitsrechtsregelung über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (ARR-Inflationsausgleich TV-L)
(RS 461.2)
Im Kirchlichen Amtsblatt Hannovers 1/2025 ist ab Seite 5 der Beschluss der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die Arbeitsrechtsregelung über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (ARR-Inflationsausgleich TV-L) bekannt gemacht worden. Dies wird hiermit zur Kenntnis gegeben.
Wolfenbüttel, den 11. August 2025
Landeskirchenamt
Bönsch
Oberlandeskirchenrätin
Oberlandeskirchenrätin
Bekanntmachung
des Beschlusses der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission über die Arbeitsrechtsregelung über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise
(ARR-Inflationsausgleich TV-L)
Hannover, den 13. Januar 2025
Nachstehend geben wir den Beschluss der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission vom 26. Januar 2024 über die Arbeitsrechtsregelung über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (ARR-Inflationsausgleich TV-L) bekannt.
Konföderation
evangelischer Kirchen
in Niedersachsen
evangelischer Kirchen
in Niedersachsen
- Geschäftsstelle -
Dr. Gäfgen-Track
##Dr. Gäfgen-Track
Arbeitsrechtsregelung
über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise
ARR Inflationsausgleich TV-L
Vom 26. Januar 2024
Aufgrund des § 14 Absatz 2 des Kirchengesetzes über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im kirchlichen Dienst (Arbeitsrechtsregelungsgesetz - ARRG-Kirche) vom 12. Dezember 2017 (KABl. Hannover 2017 S. 156) hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission folgende Arbeitsrechtsregelung beschlossen:
##§ 1
Geltungsbereich
Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für Personen, auf deren Dienstverhältnis:
- der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) nach den Maßgaben der Dienstvertragsordnung oder
- der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG) oder
- der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen (TVA-L Pflege) oder
- der Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten der Länder (TV Prakt-L) nach den Maßgaben der Arbeitsrechtsregelung für Auszubildende und Praktikantinnen (ARR-Azubi-Prakt)
§ 2
Inflationsausgleichs-Einmalzahlung
(
1
)
Personen, die unter den Geltungsbereich dieser Arbeitsrechtsregelungen fallen, erhalten eine einmalige Sonderzahlung (Inflationsausgleichs-Einmalzahlung), die zum frühestmöglichen Zeitpunkt ausgezahlt wird, wenn ihr Arbeits-, Ausbildungs- oder Praktikantenverhältnis am 9. Dezember 2023 besteht und sie in der Zeit vom 1. August 2023 bis zum 8. Dezember 2023 an mindestens einem Tag Anspruch auf Entgelt hatten.
(
2
)
1 Die Höhe der Inflationsausgleichs-Einmalzahlung beträgt für Personen, die unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 1.800 Euro. 2 Für Personen, die unter den Geltungsbereich des TVA-L BBiG, TVA-L Pflege oder der TV Prakt-L fallen, beträgt die Inflationsausgleichs-Einmalzahlung 1.000 Euro. 3 § 24 Absatz 2 TV-L gilt entsprechend. 4 Maßgeblich sind die jeweiligen Verhältnisse am 9. Dezember 2023. 5 Sofern an diesem Tag das Arbeits-, Ausbildungs- oder Praktikanten Verhältnis geruht hat, sind die Verhältnisse am Tag vor dem Beginn des Ruhens maßgeblich.
#§ 3
Inflationsausgleichs-Monatszahlungen
(
1
)
1 Personen, die unter den Geltungsbereich dieser Arbeitsrechtsregelung fallen, erhalten in den Monaten Januar 2024 bis Oktober 2024 (Bezugsmonate) monatlich Sonderzahlungen (Inflationsausgleichs-Monatszahlungen). 2 Die Auszahlung erfolgt mit dem Entgelt für den jeweiligen Bezugsmonat, die Auszahlung für die Monate Januar 2024 bis März 2024 erfolgt zum frühestmöglichen Zeitpunkt. 3 Der Anspruch auf Inflationsausgleichs-Monatszahlungen besteht jeweils nur, wenn in dem Bezugsmonat ein Arbeits-, Ausbildungs- oder Praktikantenverhältnis besteht und an mindestens einem Tag Anspruch auf Entgelt bestanden hat.
(
2
)
1 Die Höhe der Inflationsausgleichs-Monatszahlungen beträgt für Personen, die unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, in den Bezugsmonaten jeweils 120 Euro. 2 Für Personen, die unter den Geltungsbereich des TVA-L BBiG, TVA-L Pflege oder TV Prakt-L fallen, betragen die Inflationsausgleichs-Monatszahlungen in den Bezugsmonaten jeweils 50 Euro. 3 § 24 Absatz 2 TV-L gilt entsprechend. 4 Maßgeblich sind die jeweiligen Verhältnisse am ersten Tag des jeweiligen Bezugsmonats. 5 Sofern am jeweils ersten Tag des jeweiligen Bezugsmonats das Arbeits-, Ausbildungs- oder Praktikantenverhältnis ruht, sind die Verhältnisse am Tag vor dem Beginn des Ruhens maßgeblich.
#§ 4
Gemeinsame Bestimmungen für die Sonderzahlungen nach §§ 2 und 3
(
1
)
1 Die Inflationsausgleichs-Einmalzahlung nach § 2 sowie die Inflationsausgleichs-Monatszahlungen nach § 3 werden jeweils zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt gewährt. 2 Es handelt sich jeweils um einen Zuschuss des Arbeitgebers zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise im Sinne des § 3 Nummer 11c des Einkommensteuergesetzes für die Jahre 2023 und 2024.
(
2
)
1 Anspruch auf Entgelt im Sinne des § 2 Absatz 1 bzw. § 3 Absatz 1 Satz 3 sind auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 21 Satz 1 TV-L und § 29 TV-L genannten Ereignisse und der Anspruch auf Krankengeldzuschuss (§ 22 Absatz 2 und 3 TV-L), auch wenn dieser wegen der Höhe des zustehenden Krankengeldes oder einer entsprechenden gesetzlichen Leistung nicht gezahlt wird. 2 Anspruch auf Entgelt im Sinne des § 2 Absatz 1 oder § 3 Absatz 1 Satz 3 sind ferner die Ansprüche auf Entgeltfortzahlung nach §§ 9, 13 und 14 TVA-L BBiG, §§ 9, 13 und 14 TVA-L Pflege sowie nach §§ 10, 11 und 12 TV Prakt-L. 3 Einem Anspruch auf Entgelt gleichgestellt sind der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher Leistungen, Leistungen nach § 56 IfSG, Pflegeunterstützungsgeld nach § 44a Absatz 3 SGB XI, Kurzarbeitergeld und Leistungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG sowie Verletztengeld nach § 45 SGB VII.
(
4
)
Die Zahlungen nach §§ 2 und 3 sind bei der Bemessung sonstiger tariflicher Leistungen nicht zu berücksichtigen.
#§ 5
Inkrafttreten
Diese Arbeitsrechtsregelung tritt mit Wirkung vom 9. Dezember 2023 in Kraft.
Hannover, den 26. Januar 2024
#Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission
Janßen
Vorsitzender
Vorsitzender
Verordnungen
Nr. 53Bekanntmachung
der Verordnung des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Durchführung
der Ersten Theologischen Prüfung
(RS 412)
der Verordnung des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Durchführung
der Ersten Theologischen Prüfung
(RS 412)
Im Kirchlichen Amtsblatt Hannovers Nr. 01/2025, Seite 7 ist die geänderte Verordnung des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Durchführung der Ersten Theologischen Prüfung bekannt gemacht worden. Diese wird hiermit zur Kenntnis gegeben.
Wolfenbüttel, den 29. August 2025
Landeskirchenamt
Hofer
Oberlandeskirchenrat
Oberlandeskirchenrat
Verordnung des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Durchführung der Ersten Theologischen Prüfung
Vom 13. Februar 2025
Auf Grund des § 8 Absatz 2 des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die theologischen Prüfungen (Gemeinsames Prüfungsgesetz – ThPrG) vom 20. Januar 1975 (KABl. Hannover S.19), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 29. März 2001 (KABl. Hannover S. 50), erlassen wir folgende Ausführungsverordnung:
####§ 1
Regelstudienzeit
Die Regelstudienzeit des Magisterstudiengangs der Evangelischen Theologie beträgt zehn Semester. Sie erhöht sich für den Fall, dass die vorgeschriebenen Sprachkenntnisse während des Studiums erworben werden müssen, auf Antrag um ein Semester je nachzuholender Sprache, höchstens aber um insgesamt zwei Semester.
#§ 2
Prüfungsabteilungen und Unterabteilungen
(
1
)
1 Das Prüfungsamt bildet eine oder mehrere Prüfungsabteilungen und bestellt eine Vertreterin oder einen Vertreter einer der im Prüfungsamt vertretenen Kirchen zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden sowie die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden. 2 Für die mündlichen Prüfungen kann die Prüfungsabteilung Unterabteilungen bilden.
(
2
)
1 Jeder Prüfungsabteilung sollen mindestens drei Professorinnen oder Professoren der Theologischen Fakultät der Universität Göttingen angehören. 2 Zu Prüfenden und zu sachkundigen Beisitzenden dürfen nur Personen berufen werden, die die Erste Theologische Prüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt haben.
(
3
)
1 Bei Beschlüssen der Prüfungsabteilung oder einer Unterabteilung hat jedes Mitglied eine Stimme. 2 Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.
(
4
)
1 Die Mitglieder der Prüfungsabteilung sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 2 Sie unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3 Sofern sie nicht im öffentlichen oder kirchlichen Dienst stehen, sind sie durch das Prüfungsamt schriftlich zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
(
5
)
1 Die Zusammensetzung der Prüfungsabteilung wird den Kandidierenden in der Regel bei der Mitteilung über die Zulassung, spätestens jedoch drei Wochen vor dem Termin der Klausuren bekannt gegeben. 2 Sind Prüfende an der Abnahme der Prüfung verhindert, so beruft das Prüfungsamt unverzüglich Ersatzprüfende und teilt dies den Kandidierenden mit.
(
6
)
Den Mitgliedern des Prüfungsamtes ist auf ihren Wunsch Einsicht in die Prüfungsakten zu gewähren.
#§ 3
Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
(
1
)
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen im Magisterstudiengang der Evangelischen Theologie werden vom Prüfungsamt auf Antrag ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt, wenn sie an einer Theologischen Fakultät oder einer Kirchlichen Hochschule im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland erbracht wurden.
(
2
)
1 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist. 2 Die Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt und Umfang den Anforderungen des Magisterstudienganges der Evangelischen Theologie entsprechen. 3 Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 4 Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Vereinbarungen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten.
#§ 4
Öffentlichkeit der Prüfung, Niederschriften
(
1
)
Die Prüfung ist nicht öffentlich.
(
2
)
1 Für die mündliche Prüfung werden Studierende, die sich zum nächsten oder übernächsten Termin zur Ersten Theologischen Prüfung melden möchten, zur Teilnahme als studentische Zuhörende zugelassen. 2 Es sollen nicht mehr als fünf studentische Zuhörende an einer Prüfung teilnehmen. 3 Auf Wunsch von Kandidierenden entfällt die Teilnahme der studentischen Zuhörenden für die Dauer der betreffenden Prüfung. 4 Studentische Zuhörende können ausgeschlossen werden, wenn durch ihre Anwesenheit die Gefahr der Beeinträchtigung der Prüfung gegeben ist.
(
3
)
1 Die Mitglieder des Prüfungsamtes haben das Recht, nach vorheriger Absprache mit dem oder der Vorsitzenden der Prüfungsabteilung an der mündlichen Prüfung als Zuhörende teilzunehmen. 2 Das Prüfungsamt kann weitere mit der Prüfung befasste Personen als Zuhörende zulassen.
(
4
)
1 Über jeden Prüfungsvorgang ist eine Niederschrift anzufertigen und zu den Prüfungsakten zu nehmen. 2 Die Niederschrift über den Verlauf der mündlichen Prüfung soll den Prüfungsgang und die Bewertung der Prüfungsleistungen zusammenfassend wiedergeben.
#§ 5
Zulassungsvoraussetzungen
Die Zulassung zur Ersten Theologischen Prüfung setzt voraus:
- das Zeugnis über die bestandene Zwischenprüfung entsprechend der Rahmenordnung für die Zwischenprüfung im Studiengang „Evangelische Theologie“ (Erste Theologische Prüfung/Magister Theologiae) vom 24. Februar 2023 (ABl. EKD 2023, S. 18) in der jeweils geltenden Fassung;
- den Nachweis der Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschlandund entweder
- den Nachweis eines ordnungsgemäßen Studiums der Evangelischen Theologie gemäß der Rahmenordnung für den Studiengang „Evangelische Theologie“ (Pfarramt/Diplom/Magister Theologiae) vom 26./27. März 2009 (ABl. EKD 2009, S. 113) in der jeweils geltenden Fassung und der Übersicht über die Gegenstände des Studiums der Evangelischen Theologie vom 23./24. März 2012 (ABl. EKD 2012, S. 359) in der jeweils geltenden Fassung, erteilt von einer Theologischen Fakultät oder einer Kirchlichen Hochschule im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschlandoder
- den Nachweis über den Abschluss des Hauptstudiums (120 LP) und den Eintritt in die Integrationsphase;
- den Nachweis von drei mit mindestens „ausreichend“ bestandenen Modulabschluss-Prüfungen auf der Grundlage von Hauptseminararbeiten aus drei verschiedenen der folgenden Fächer: Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, Systematische Theologie;
- Nachweis über die Anfertigung einer homiletischen Arbeit;
- Nachweis über die Anfertigung eines Unterrichtsentwurfs;
- den Nachweis über eine mündliche Prüfung im Fach Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie;
- den Nachweis über eine mündliche Prüfung in Philosophie;
- den Nachweis über die Teilnahme an Lehrveranstaltungen in einem gewählten Schwerpunkt des Studiums;
- den Nachweis mindestens eines Praktikums einschließlich Auswertung gemäß der Richtlinie für das Praktikum im Studiengang „Evangelische Theologie“ (Pfarramt/ Diplom/Magister Theologiae) vom 26./27. März 2009 (ABl. EKD 2009, S. 115) in der jeweils geltenden Fassung.
§ 6
Meldung zur Ersten Theologischen Prüfung
(
1
)
1 Die Meldung zur Ersten Theologischen Prüfung ist an die zuständige Stelle einer der im Prüfungsamt vertretenen Kirchen zu richten. 2 Meldeschluss ist der 1. Mai und der 1. November eines jeden Jahres. 3 In besonders begründeten Einzelfällen kann das Prüfungsamt Ausnahmen zulassen.
(
2
)
Mit der Meldung sind zusätzlich zu den in § 5 genannten Nachweisen folgende Unterlagen im Original oder in amtlich beglaubigter Form vorzulegen:
- Geburtsurkunde und gegebenenfalls Urkunde über eine Namensänderung;
- die Vorlage eines Studienberichts;
- Themenvorschläge für ausgewählte Überblickskenntnisse und Spezialkenntnisse der mündlichen Prüfungen;
- eine Erklärung darüber, in welchem Prüfungsfach die Wissenschaftliche Hausarbeit geschrieben werden soll, sofern sie nicht schon vor der Zulassung absolviert wurde;
- gegebenenfalls ein Vorschlag für ein Themengebiet für die Wissenschaftliche Hausarbeit und ein Vorschlag für eine Erstgutachterin oder einen Erstgutachter;
- im Falle einer interdisziplinären Wissenschaftlichen Hausarbeit die Angabe des Fachgebiets, in dem keine Abschlussklausur angefertigt werden soll;
- gegebenenfalls Anträge zu Form und Durchführung der Ersten Theologischen Prüfung, insbesondere zum Vorziehen von Prüfungsteilen und zur Durchführung einer interdisziplinären mündlichen Abschlussprüfung, eines Streitgesprächs oder einer forschungsorientierten Prüfung;
- Angaben über vorangegangene Meldungen zur Ersten Theologischen Prüfung und zur Prüfung zur Magistra Theologiae bzw. zum Magister Theologiae und deren Erfolge;
- eine Erklärung, dass die Bewerberin oder der Bewerber sich bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens nicht an anderer Stelle zur Ersten Theologischen Prüfung oder zur Prüfung zur Magistra Theologiae bzw. zum Magister Theologiae anmelden wird;
- die Mitteilung, ob die Bewerberin oder der Bewerber mit der Teilnahme von Zuhörenden an der mündlichen Prüfung einverstanden ist.
(
3
)
Soweit Prüfungsteile über mehrere Prüfungsphasen verteilt werden, können Vorschläge nach Absatz 2 Buchstabe c) bis g) bis zu dem Anmeldetermin nach Absatz 1 Satz 2 vor Beginn der jeweils betroffenen Prüfungsphase vorgelegt werden.
#§ 7
Zulassung zur Prüfung, Zuweisung zu einer Prüfungsabteilung
(
1
)
1 Das Prüfungsamt entscheidet in angemessener Frist über die Zulassung. 2 Diese ist zu versagen oder zu widerrufen, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht vollständig nachgewiesen und erfüllt oder entfallen sind, die Erste Theologische Prüfung oder die Prüfung zur Magistra Theologiae bzw. zum Magister Theologiae an einer Theologischen Fakultät oder einer Kirchlichen Hochschule im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland oder eine vergleichbare Prüfung an einer Hochschule im In- oder Ausland oder vor einer Prüfungskommission einer Gliedkirche der EKD endgültig nicht bestanden wurde oder andernorts eine Anmeldung zu einer solchen Prüfung erfolgt ist. 3 Bei Ablehnung oder Widerruf der Zulassung ist den Bewerbenden eine schriftliche Begründung zu geben. 4 Bei Eilbedürftigkeit kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsamtes eine vorläufige Entscheidung über den Antrag auf Zulassung aussprechen, die der Bestätigung durch das Prüfungsamt bedarf.
(
2
)
Das Prüfungsamt weist die Kandidierenden einer Prüfungsabteilung zu und setzt Ort und Zeit der einzelnen Prüfungsvorgänge fest.
(
3
)
Den Kandidierenden wird die Möglichkeit gegeben, sich spätestens zwei Wochen vor dem Termin der mündlichen Prüfung persönlich bei ihren Prüfenden vorzustellen.
#§ 8
Prüfungsfächer
Prüfungsfächer der Ersten Theologischen Prüfung sind:
- Altes Testament;
- Neues Testament;
- Kirchengeschichte;
- Systematische Theologie (Dogmatik und Ethik);
- Praktische Theologie.
§ 9
Prüfungsteile, Prüfungsfächer und Fachprüfungen
(
1
)
Die Erste Theologische Prüfung besteht aus folgenden Prüfungsteilen:
- einer Wissenschaftlichen Hausarbeit;
- drei oder vier Abschlussklausuren;
- vier oder fünf mündlichen Abschlussprüfungen.
(
2
)
Die Prüfungsteile sind nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen in den Prüfungsfächern
- Altes Testament;
- Neues Testament;
- Kirchengeschichte;
- Systematische Theologie (Dogmatik und Ethik);
- Praktische Theologie
zu erbringen.
(
3
)
1 Die Prüfung gliedert sich in Fachprüfungen. 2 Die Fachprüfungen bestehen aus einem schriftlichen und einem mündlichen Prüfungsteil.
(
4
)
1 In dem Fach, in dem die Wissenschaftliche Hausarbeit geschrieben wird, entfällt die Abschlussklausur und die mündliche Abschlussprüfung zählt als Fachprüfung. 2 Wird die Wissenschaftliche Hausarbeit als interdisziplinäre Arbeit mit einem weiteren theologischen Fach geschrieben, wählen die Kandidierenden, in welchem der beiden theologischen Fächer die Abschlussklausur entfällt.
(
5
)
Wird die mündliche Abschlussprüfung in einem Fach als forschungsorientierte Prüfung durchgeführt, gilt die eingereichte Forschungsleistung als schriftlicher Prüfungsteil der Fachprüfung.
(
6
)
1 Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Fachnote aus dem Durchschnitt der einzelnen Prüfungsleistungen. 2 Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.
(
7
)
Zur Durchführung der Ersten Theologischen Prüfung werden jährlich zwei Prüfungsphasen angeboten, die sich auf die Zeiträume Februar bis Juli und August bis Januar erstrecken.
(
8
)
1 Die Prüfungsteile der Ersten Theologischen Prüfung werden innerhalb derselben Prüfungsphase absolviert. 2 Auf Antrag können die Kandidierenden eine Abschlussklausur oder zwei Abschlussklausuren unterschiedlicher Fächer oder die gesamte Fachprüfung eines Fachs in einer Prüfungsphase, die übrigen Prüfungsteile in der darauffolgenden Prüfungsphase absolvieren. 3 Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann das Prüfungsamt weitere Ausnahmen zulassen. 4 Als wichtiger Grund gelten insbesondere Krankheit und sonstige Arbeitsunfähigkeit, die durch ein ärztliches Attest zu belegen sind; die Bestimmungen zum Nachteilsausgleich bleiben unberührt.
(
9
)
1 Studierende, die auf einer der Listen der Kirchen der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen geführt werden, können die Wissenschaftliche Hausarbeit nach Anmeldung beim Prüfungsamt abweichend von Absatz 8 nach vier Semestern im Hauptstudium einmalig auch vor Zulassung zur Ersten Theologischen Prüfung absolvieren. 2 Ein etwaiger Fehlversuch wird bei der Zulassung zur Ersten Theologischen Prüfung angerechnet. 3 Wissenschaftliche Hausarbeiten, die an einer Theologischen Fakultät oder einer Kirchlichen Hochschule im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland oder andernorts vorgezogen absolviert wurden, können nach Maßgabe des § 3 dieser Ordnung anerkannt oder angerechnet werden.
#§ 10
Abschlussklausuren
(
1
)
1 Abschlussklausuren werden in allen fünf Prüfungsfächern des § 8 mit Ausnahme des oder der beiden Fächer geschrieben, in denen die Wissenschaftliche Hausarbeit geschrieben oder eine forschungsorientierte Prüfung durchgeführt wird. 2 In den Abschlussklausuren sollen die Kandidierenden nachweisen, dass sie auf der Basis des notwendigen Grundwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des jeweiligen Fachs Themen bearbeiten können.
(
2
)
Für jede Abschlussklausur sind drei Themen zur Auswahl und vier Stunden zur Verfügung zu stellen.
(
3
)
Zur Verwendung in den Abschlussklausuren sind ausschließlich folgende Hilfsmittel zugelassen:
- Altes Testament: Biblia Hebraica und hebräisches Wörterbuch (Gesenius);
- Neues Testament: Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland) und griechisches Wörterbuch (Bauer);
- Systematische Theologie: Lutherbibel revidiert 2017 und Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (BSLK);
- Kirchengeschichte: Lateinisches Wörterbuch (Georges), sofern ein lateinischer Text Bestandteil der Klausuraufgabe ist.
§ 11
Mündliche Abschlussprüfungen
(
1
)
1 Mündliche Abschlussprüfungen sind in allen fünf Prüfungsfächern nach § 8 zu absolvieren, soweit sich aus den Absätzen 4 bis 6 dieser Vorschrift nichts anderes ergibt. 2 Durch die mündlichen Abschlussprüfungen sollen die Kandidierenden nachweisen, dass sie über ein dem Studienziel entsprechendes Grundwissen verfügen, die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und ein selbst gewähltes Spezialgebiet mit seinen Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen und kritisch zu beurteilen vermögen.
(
2
)
1 Die mündliche Abschlussprüfung erstreckt sich jeweils auf ausgewählte Überblickskenntnisse des jeweiligen Fachs sowie ein mit den Prüfenden abzusprechendes Spezialgebiet des Fachs, im Fach Systematische Theologie auf zwei Spezialgebiete (Dogmatik und Ethik). 2 In den Fächern Altes Testament und Neues Testament wird zudem für die Übersetzung eine Auswahl aus dem hebräischen beziehungsweise altgriechischen Bibeltext festgelegt. 3 Die Absprachen über die Spezialgebiete sind aktenkundig zu machen.
(
3
)
1 Die Prüfungsdauer beträgt in den Fachgebieten Altes Testament und Neues Testament jeweils ungefähr 25 Minuten, im Fachgebiet Kirchengeschichte ungefähr 20 Minuten, im Fachgebiet Systematische Theologie ungefähr 40 Minuten und im Fachgebiet Praktische Theologie ungefähr 20 Minuten. 2 Die Prüfung wird jeweils vor zwei Prüfenden oder vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers abgelegt.
(
4
)
1 Auf Antrag der Kandidierenden können einmalig zwei der mündlichen Abschlussprüfungen mit Ausnahme des Fachgebiets, in dem die Abschlussklausur entfällt, zu einer interdisziplinären mündlichen Abschlussprüfung zusammengefasst werden. 2 Die interdisziplinäre mündliche Abschlussprüfung hat bei Beteiligung eines exegetischen Fachs oder der beiden exegetischen Fächer einen Umfang von ungefähr 35 Minuten, im Übrigen einen Umfang von ungefähr 30 Minuten und wird abweichend von Absatz 3 Satz 2 stets vor zwei Prüfenden aus beiden beteiligten Fachgebieten abgelegt. 3 Absatz 2 gilt entsprechend, wobei für jedes beteiligte Fachgebiet ein Spezialgebiet abzustimmen ist.
(
5
)
1 Auf Antrag der Kandidierenden kann genau eine der mündlichen Abschlussprüfungen, auch eine interdisziplinäre mündliche Abschlussprüfung, als wissenschaftliches Streitgespräch durchgeführt werden. 2 In diesem Fall haben die Kandidierenden eine Woche vor dem Prüfungstermin ein Thesenpapier vorzulegen, das Grundlage des wissenschaftlichen Streitgesprächs ist. 3 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt.
(
6
)
1 Auf Antrag der Kandidierenden kann eine der mündlichen Abschlussprüfungen, nicht jedoch eine interdisziplinäre mündliche Abschlussprüfung, als forschungsorientierte Abschlussprüfung durchgeführt werden. 2 Die forschungsorientierte Prüfung ist ein Prüfungsgespräch, das im Fach Altes Testament und im Fach Neues Testament einen Umfang von ungefähr 35 Minuten, in den anderen Fächern einen Umfang von ungefähr 30 Minuten hat und sich auf folgende Gegenstände bezieht:
- das Thema einer mit „sehr gut“ bewerteten Hauptseminararbeit der Kandidierenden aus diesem Fach und dessen Einordnung in den breiteren Forschungskontext dieses Fachs;
- Grundwissen aus wenigstens einem weiteren Teilgebiet des Fachs;
- im Fach Altes Testament und im Fach Neues Testament eine Übersetzung aus dem Hebräischen oder Griechischen, wobei in der Regel ein Text mit Bezug zum Thema der Hauptseminararbeit zu bearbeiten ist.
§ 12
Anfertigung der Wissenschaftlichen Hausarbeit
(
1
)
1 Die Wissenschaftliche Hausarbeit soll zeigen, dass die Kandidierenden in der Lage sind, ein wissenschaftliches Problem innerhalb einer vorgegebenen Frist und in einem bestimmten Umfang selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 2 Für die Anfertigung der Wissenschaftlichen Hausarbeit erhalten die Kandidierenden eine Frist von zwölf Wochen. 3 Die Wissenschaftliche Hausarbeit soll einschließlich der Anmerkungen und der Leerzeichen einen Umfang von 144.000 Zeichen nicht überschreiten. 4 Das Prüfungsamt kann in begründeten Ausnahmefällen eine Überschreitung um bis zu 10 Prozent zulassen.
(
2
)
1 Das Prüfungsamt legt das Thema für die Wissenschaftliche Hausarbeit fest. 2 Es ist dabei an das von den Kandidierenden aus den Prüfungsfächern Altes Testament, Neues Testament, Systematische Theologie, Kirchengeschichte und Praktische Theologie gewählte Prüfungsfach gebunden. 3 Das Thema kann auch aus zwei Prüfungsfächern gewählt werden (interdisziplinäre Wissenschaftliche Hausarbeit). 4 Den Themenbereich vereinbaren die Kandidierenden mit der Erstgutachterin oder dem Erstgutachter. 5 Ein Rechtsanspruch auf Ausgabe des vereinbarten Themas besteht nicht. 6 Die Themenausgabe ist aktenkundig zu machen.
(
3
)
1 Am Schluss der Wissenschaftlichen Hausarbeit haben die Kandidierenden zu versichern, dass sie diese selbstständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und sämtliche wörtlichen und inhaltlichen Anführungen aus der Literatur als solche kenntlich gemacht haben. 2 Ein vollständiges Verzeichnis der benutzten Literatur ist beizufügen.
(
4
)
1 Die Wissenschaftliche Hausarbeit ist fristgemäß in digitaler Form beim Prüfungsamt abzugeben und zusätzlich in zweifacher Ausfertigung ausgedruckt einzureichen oder postalisch abzugeben. 2 Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen; für die Fristwahrung entscheidend ist der Eingang der digitalen Fassung.
(
5
)
1 Das Prüfungsamt leitet die Wissenschaftliche Hausarbeit der Erstgutachterin oder dem Erstgutachter und einer weiteren Gutachterin oder einem weiteren Gutachter zu. 2 Bei interdisziplinären Wissenschaftlichen Hausarbeiten sind Vertreterinnen oder Vertreter beider Fachgebiete zu beteiligen. 3 Jede Gutachterin und jeder Gutachter vergibt eine Note. 4 Die Dauer des Bewertungsverfahrens soll sechs Wochen nicht überschreiten.
#§ 13
Prüfungsergebnisse
(
1
)
Die einzelnen Prüfungsleistungen werden wie folgt bewertet:
- „sehr gut“ (15/14/13): eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung;
- „gut“ (12/11/10): eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung;
- „befriedigend“ (9/8/7): eine im Allgemeinen den Anforderungen entsprechende Leistung;
- „ausreichend“ (6/5/4): eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht;
- „mangelhaft“ (3/2/1): eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, die jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können;
- „ungenügend“ (0): eine Leistung, die wegen fehlender Grundkenntnisse den Anforderungen in keiner Weise entspricht und die nicht erkennen lässt, dass die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können.
(
2
)
1 Die schriftlichen Arbeiten werden durch je zwei Prüfende korrigiert. 2 Bei abweichenden Voten wird die Note durch das arithmetische Mittel beider Notenvorschläge gebildet. 3 Weichen die Voten über mehr als eine Notenstufe voneinander ab und verständigen sich die Prüfenden nicht auf ein gemeinsames Votum, so entscheidet das Prüfungsamt über die Endnote.
(
3
)
Über die Bewertung der mündlichen Prüfungen beschließt die Prüfungsabteilung bzw. ihre Unterabteilungen.
(
4
)
1 Nach Beendigung der Prüfung stellt das Prüfungsamt das Schlussergebnis aufgrund der vorliegenden Bewertungen der Prüfungsleistungen fest. 2 Es wird in folgenden Noten zusammengefasst:
- „sehr gut“ bestanden;
- „gut“ bestanden;
- „befriedigend“ bestanden;
- „ausreichend“ bestanden;
- „nicht bestanden“.
(
5
)
Die Prüfung ist bestanden, wenn alle Fachprüfungen und die Wissenschaftliche Hausarbeit mit mindestens „ausreichend“ bewertet worden sind.
(
6
)
1 Haben Kandidierende eine oder zwei Fachprüfungen nicht bestanden, erhalten sie die Möglichkeit einer Nachprüfung (§ 16). 2 Ebenso kann eine nicht bestandene Wissenschaftliche Hausarbeit einmal wiederholt werden. 3 Insgesamt dürfen jedoch nur in zwei Fächern Nachprüfungen absolviert werden. 4 Wurden mehr als zwei Fachprüfungen schlechter als „ausreichend“ bewertet, ist die gesamte Prüfung nicht bestanden.
(
7
)
1 Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durchschnitt der Punkte für die einzelnen Fachprüfungen. 2 Die Note für die Wissenschaftliche Hausarbeit wird dabei doppelt gewertet. 3 Auf Antrag der Kandidierenden, der nach Abschluss aller Prüfungsteile gestellt werden kann, sind bei der Bildung der Gesamtnote ergänzend die Modulnoten von wenigstens zwei und höchstens vier Modulen des Hauptstudiums, jeweils einfach gewichtet, zu berücksichtigen.
(
8
)
1 Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 2 Dem ermittelten Notenwert entsprechen folgende Noten:
- „sehr gut“ bestanden bei einer Durchschnittspunktzahl von 15 bis 12,5 Punkten;
- „gut“ bestanden bei einer Durchschnittspunktzahl von 12,4 bis 9,5 Punkten;
- „befriedigend“ bestanden bei einer Durchschnittspunktzahl von 9,4 bis 6,5 Punkten;
- „ausreichend“ bestanden bei einer Durchschnittspunktzahl von 6,4 bis 4,0 Punkten;
- „nicht bestanden“ bei einer Durchschnittspunktzahl von 3,9 bis 0 Punkten.
§ 14
Rücktritt und Versäumnis
(
1
)
1 Eine Teilprüfung gilt als nicht bestanden, wenn Kandierende einen Prüfungstermin ohne triftige Gründe versäumen oder nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktreten. 2 Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.
(
2
)
Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt oder mündlich zu Protokoll gegeben werden.
(
3
)
Bestehen die zwingenden Gründe in einer Erkrankung, so ist unverzüglich eine vom Tage der Erkrankung, spätestens vom Tage der Prüfungsleistung datierende ärztliche Bescheinigung vorzulegen und in Zweifelsfällen ein Attest einer oder eines vom Prüfungsamt benannten Ärztin oder Arztes vorzulegen.
(
4
)
1 Werden die Gründe vom Prüfungsamt anerkannt, wird die Frist zur Anfertigung der wissenschaftlichen Hausarbeit um insgesamt höchstens zwölf Werktage verlängert. 2 Liegen Gründe vor, die eine Verlängerung der Frist zur Anfertigung der wissenschaftlichen Hausarbeit um mehr als zwölf Werktage rechtfertigen, so wird die Kandidatin oder der Kandidat zum nächstmöglichen Termin erneut zugelassen. 3 Die bereits vorliegenden Prüfungsleistungen sind in diesem Fall anzurechnen.
(
5
)
1 Kandidierende können vor Beginn der ersten Prüfungsleistung ohne Angabe von Gründen von der Prüfung zurücktreten. 2 Der Rücktritt ist aktenkundig zu machen. 3 In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht unternommen. 4 Ein solcher Rücktritt ist nur einmal möglich. 5 Die Kandidierenden können zum nächstmöglichen Termin erneut zugelassen werden.
#§ 15
Täuschung und andere Verstöße gegen die Ordnung
(
1
)
1 Bei einem Täuschungsversuch, der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder anderen Verstößen gegen die Prüfungsordnung entscheidet die Prüfungsabteilung, wie zu verfahren ist. 2 Das Prüfungsamt hat allein zu entscheiden, wenn die Prüfungsabteilung nicht versammelt ist.
(
2
)
1 In leichten Fällen kann die Wiederholung der Prüfung oder eines Prüfungsteils angeordnet, in schweren Fällen die Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. 2 Im Wiederholungsfalle kann das Prüfungsamt Kandidierende von jeder weiteren Prüfung ausschließen; die Prüfung ist dann endgültig nicht bestanden.
(
3
)
1 Werden Verstöße gegen die Prüfungsordnung nachträglich bekannt, so kann das Prüfungsamt die Prüfung für nicht bestanden erklären, wenn nicht mehr als drei Jahre nach Zustellung des Prüfungsergebnisses verstrichen sind. 2 Das Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen.
#§ 16
Nachprüfung
(
1
)
1 Im Fall der Nachprüfung gemäß § 13 Absatz 6 gilt die Prüfung als nicht abgeschlossen. 2 Bei der Nachprüfung haben die Kandidierenden die Möglichkeit, die nicht bestandenen Fachprüfungen zu wiederholen. 3 Dabei müssen alle Teile der nicht bestandenen Fachprüfungen wiederholt werden.
(
2
)
1 Wird gemäß § 13 eine Nachprüfung angeordnet, so setzt das Prüfungsamt Zeit und Ort der Nachprüfung fest. 2 Sie findet in der Regel im Rahmen des nächsten Prüfungstermins statt.
(
3
)
Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn in der Nachprüfung die wiederholten Fachprüfungen nicht mit jeweils mindestens „ausreichend“ bewertet wurden.
#§ 17
Wiederholung der Prüfung, Freiversuch
(
1
)
1 Wer die Prüfung beim ersten Versuch nicht bestanden hat, kann zum nächstmöglichen Termin erneut zugelassen werden. 2 Ist die Prüfung nach § 15 für „nicht bestanden“ erklärt worden, so kann der Prüfling zum nächstmöglichen Termin zugelassen werden.
(
2
)
1 Der Zeitraum zwischen der ersten und der erneuten Meldung zur Prüfung darf zwei Jahre nicht überschreiten. 2 Das Prüfungsamt kann in besonderen Fällen Ausnahmen von dieser Bestimmung zulassen.
(
3
)
1 Wer die Prüfung auch beim zweiten Versuch nicht bestanden hat, soll ein drittes Mal nicht wieder zugelassen werden. 2 In besonders begründeten Ausnahmefällen kann das Prüfungsamt einen dritten Versuch zulassen.
(
4
)
1 Eine erstmals nicht bestandene Erste Theologische Prüfung gilt als nicht unternommen, wenn sie innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt worden ist (Freiversuch). 2 Das Sommersemester 2020, das Wintersemester 2020/21, das Sommersemester 2021 und das Wintersemester 2021/2022 bleiben bei der Berechnung der Regelstudienzeit unberücksichtigt, soweit die Kandidierenden in den betreffenden Semestern nicht beurlaubt waren. 3 Eine innerhalb der Regelstudienzeit bestandene Erste Theologische Prüfung kann zur Notenverbesserung innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden; dabei zählt jeweils das bessere Ergebnis jedes Prüfungsteils. 4 Sprachsemester sind bei der Berechnung der Regelstudienzeit zu Gunsten der Kandidierenden nur zu berücksichtigen, soweit sie oder er diese zum Erwerb der erforderlichen Sprachkenntnisse benötigt hat. 5 Die Regelungen über den Freiversuch gelten nicht für den Fall, dass die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen Verhaltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht bestanden erklärt wurde.
(
5
)
Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Kandidierende, die die Erste Theologische Prüfung oder die Prüfung zur Magistra Theologiae bzw. zum Magister Theologiae oder eine vergleichbare Prüfung an einer Hochschule im In- oder Ausland oder vor einer Prüfungskommission einer Gliedkirche der EKD nicht bestanden haben.
#§ 18
Zeugnis
Die Kandidierenden erhalten nach Abschluss der Prüfung ein Zeugnis, das die Gesamtnote, den Punktedurchschnitt und die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen, die bei der Bildung der Gesamtnote antragsgemäß berücksichtigten Module und Modulnoten der Module des Hauptstudiums sowie das Thema der Wissenschaftlichen Hausarbeit ausweist.
#§ 19
Akteneinsicht
(
1
)
1 Die Kandidierenden haben das Recht, innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens ihre vollständigen Prüfungsakten in der für sie zuständigen aktenführenden Stelle persönlich einzusehen, wenn sie innerhalb von drei Monaten nach Zustellung des Zeugnisses die Akteneinsicht beantragen. 2 Nebenakten dürfen nicht geführt werden. 3 Waren Kandidierende ohne Verschulden verhindert, die Dreimonatsfrist einzuhalten, ist ihnen auf Antrag die nachträgliche Einsichtnahme zu gestatten. 4 Den Antrag haben die Kandidierenden binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hinderungsgrundes an die für sie zuständige aktenführende Stelle zu richten.
(
2
)
Das Prüfungsamt kann in besonderen Fällen auch bei nicht abgeschlossenen Prüfungen Akteneinsicht gewähren.
#§ 20
Erlass von Richtlinien
(
1
)
Das Prüfungsamt erlässt im Rahmen des Gemeinsamen Prüfungsgesetzes und dieser Ausführungsverordnung Richtlinien über die Gestaltung der Prüfung.
(
2
)
1 Beschlüsse des Prüfungsamtes gemäß Absatz 1 werden einmütig gefasst. 2 Ist keine Einmütigkeit zu erzielen, so holt das Prüfungsamt die Entscheidung des Rates ein.
#§ 21
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen
1 Diese Verordnung tritt am 1. April 2025 in Kraft. 2 Gleichzeitig tritt die Verordnung des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Durchführung der Ersten theologischen Prüfung vom 9. März 2013 (K ABl. Hannover 2013, S. 39), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. September 2020 (K ABl. Hannover 2020, S. 106) außer Kraft.
Der Rat der Konföderation
evangelischer Kirchen in Niedersachsen
evangelischer Kirchen in Niedersachsen
Adomeit
Vorsitzender
Vorsitzender
Kirchensiegel
Nr. 54Außergebrauchnahme
Gemäß § 26 der Siegelordnung vom 3. Juli 1984 (ABl. 1984 S. 73 ff) wird bekannt gemacht:
Nachstehende abgebildete Kirchensiegel sind außer Gebrauch und außer Geltung gesetzt worden:
- 1.
- Ev.-luth. Kirchengemeinde an der Ohe / SicktePropstei KönigslutterSiegelausführung:
- 1 Normalsiegel in Gummi
- 2.
- Ev.-luth. Kirchengemeinde Kreuzkirche Alt Lehndorf in BraunschweigPropstei BraunschweigSiegelausführung:
- 1 Normalsiegel in Gummi
- 3.
- Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Jürgen zu Ölper in BraunschweigPropstei BraunschweigSiegelausführung:
- 1 Normalsiegel in Gummi
- 4.
- Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien Lamme in BraunschweigPropstei BraunschweigSiegelausführung:
- 1 Normalsiegel in Gummi
- 5.
- Ev.-luth. Kirchengemeinde Wichern Braunschweig Lehndorf-KanzlerfeldPropstei BraunschweigSiegelausführung:
- 2 Normalsiegel in Gummi
(mit den Beizeichen „+“ und „+ +“)
Wolfenbüttel, den 13. August 2025
Landeskirchenamt
Bönsch
Oberlandeskirchenrätin
Oberlandeskirchenrätin
Änderung in der Zusammensetzung
Nr. 55Bekanntmachung
Änderung in der Zusammensetzung
der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission
Änderung in der Zusammensetzung
der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission
Im Kirchlichen Amtsblatt Hannovers 1/2025 ist ab Seite 5 folgende Änderung in der Zusammensetzung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission bekannt gemacht worden. Dies wird hiermit zur Kenntnis gegeben.
Wolfenbüttel, den 22. August 2025
Landeskirchenamt
Bönsch
Oberlandeskirchenrätin
Oberlandeskirchenrätin
Änderung in der Zusammensetzung
der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission
Hannover, den 17. Februar 2025
Die Zusammensetzung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission (Mitteilung vom 11. Dezember 2023 - KABl. Hannover 2024 S. 100) hat sich wie folgt geändert:
####- als Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft
- d)
- von der Kirchengewerkschaft, Niedersachsen
- •
- Alexander Dohe, bisher Vollmitglied der ADK, scheidet zum 30. Juni 2024 aus der ADK aus.
- •
- Frau Simone Pörtgen-Kraus wird als Mitglied in die ADK entsandt.
- •
- Herr Hubert Rieping, bisher stellvertretendes Mitglied für Herrn Alexander Dohe, scheidet aus der ADK aus.
- •
- Frau Anke Sump wird als Stellvertreterin für Frau Simone Pörtgen-Kraus in die ADK entsandt.
- •
- Frau Christel Orb-Runge wird als Mitglied in die ADK entsandt.
- e)
- von der AG VkM, Niedersachsen
- •
- Herr Rüdiger Nijenhof wird als Vollmitglied mit Wirkung zum 1. Mai 2024 in die ADK entsandt.
Konföderation
evangelischer Kirchen
in Niedersachsen
evangelischer Kirchen
in Niedersachsen
- Geschäftsstelle -
Dr. Gäfgen-Track
Dr. Gäfgen-Track
Personal- und Stellenangelegenheiten
Nr. 56Ausschreibung von Pfarrstellen und anderen Stellen
Pfarrstellen und andere Stellen werden jeden ungeraden Monat für vier Wochen unter www.landeskirche-braunschweig.de/aktuell/stellen ausgeschrieben.
Nachrichtlich:
Für die Hochsaison 2026 (Mai bis September und Weihnachten) sind im Bereich der Ev.-Luth. Kirche in Bayern ca.
70 Kur- und Urlauberseelsorgeeinsätze
40 Kur- und Urlauberkantoreneinsätze
ausgeschrieben.
Informationen zu den Einsätzen und Bewerbungsunterlagen können ab Oktober im Referat Kirche in Tourismus und Sport per E-Mail (dalena.straninger@elkb.de) angefordert werden. Die Bewerbungen müssen per E-Mail auf dem Dienstweg und zusätzlich an oben genannter Adresse bis spätestens 24. November 2025 vorliegen.
Nr. 57Personalnachrichten
####Besetzung und Verwaltung von Pfarrstellen und anderen Stellen
Die Pfarrstelle im Kirchengemeindeverband Maria von Magdala in Wolfenbüttel Bezirk III im Umfang von 100 % ab 1. Juli 2025 mit Pfarrerin Julia Jansen, bisher Probedienst.
Die Pfarrstelle in der Propstei Salzgitter Bezirk III im Umfang von 100 % ab 1. August 2025 mit Pfarrer Tobias Crins, bisher Kirchengemeindeverband Königslutter Bezirk V.
Die Pfarrstelle im Pfarrverband Braunschweig-Mitte Bezirk II im Umfang von 100 % ab 1. August 2025 mit Pfarrer Karsten Höpting, bisher Pfarrverband Harzer Land Bezirk II.
Die Pfarrstelle im Pfarrverband Am Drömling Bezirk VI im Umfang von 100 % ab 1. September 2025 mit Pfarrerin Rebekka Schönfelder, bisher Propstei Salzgitter Bezirk IX.
Die Stelle mit allgemeinkirchlicher Aufgabe Dienst in der Telefonseelsorge im Umfang von 100 % ab 1. September 2025 mit Pfarrerin Dagmar Reumke, vorher Stelle mit allgemeinkirchlicher Aufgabe persönliche Referentin des Landesbischofs.
#Korrektur
Die Pfarrstelle im Kirchengemeindeverband Braunschweiger Süden Bezirk I im Umfang von 100 % ab 1. Juli 2025 mit Pfarrerin Rebekka Gottwald, bisher Vikarin (Korrektur der Schreibweise des Namens unter Nr. 46 im ABl. 2025 vom 15. Juli 2025).
#Veränderungen, Versetzungen, Beurlaubungen, Ernennungen, Entlassungen
Pfarrer Jonas Stark wurde mit Wirkung vom 1. Juli 2025 zum Stellvertreter der Pröpstin/des Propstes der Propstei Königslutter ernannt.
Pfarrer Frank Wesemann wurde mit Wirkung vom 1. Juli 2025 zum Stellvertreter der Pröpstin der Propstei Vechelde ernannt.
Pfarrerin Jonah Klee wurde mit Wirkung vom 1. September 2025 für einen Dienst bei der EKD im Amtsbereich der VELKD beurlaubt, bisher Stelle als Studieninspektorin im Theologischen Zentrum.
Pfarrer Christoph Holstein wurde mit Wirkung vom 1. September 2025 für den Dienst in der Ev. Kirche im Rheinland beurlaubt, bisher beurlaubt für einen EKD-Auslandsdienst.
#Ruhestand
Landesbischof Dr. Christoph Meyns, Wolfenbüttel, wurde mit Ablauf des 31. Juli 2025 in den Ruhestand versetzt.
Pfarrer Claus-Dieter Sonnenberg, Lengede, wurde mit Ablauf des 31. Juli 2025 in den Ruhestand versetzt.
Pfarrer Bernhard Sieverling, Süpplingen, wurde mit Ablauf des 31. August 2025 in den Ruhestand versetzt.
Pfarrer Christian Kohn, Braunschweig, wurde mit Ablauf des 31. August 2025 in den Ruhestand versetzt.
Pfarrer Frank Barche, Büddenstedt, wurde mit Ablauf des 30. September 2025 in den Ruhestand versetzt.
#Verstorben
Landeskirchenoberamtsrat i. R. Martin Weitemeier, Wolfenbüttel, ist am 25. August 2025 verstorben.
#Landeskirchenamt
Herr Dr. Andreas Schneedorf wurde mit Wirkung vom 1. April 2025 zum Landeskirchenrat ernannt.
Herr Pfarrer Dr. Christopher Kumitz-Brennecke wurde mit Wirkung vom 1. September 2025 zum Landeskirchenrat ernannt.
Frau Landeskirchenamtsinspektorin Petra Eggeling wurde mit Ablauf des 31. Juli 2025 in den Ruhestand versetzt.
#Wolfenbüttel, 1. Oktober 2025
Landeskirchenamt
Brand-Seiß
Oberlandeskirchenrätin
Oberlandeskirchenrätin
Hinweis der Amtsblattredaktion
Das Landeskirchliche Amtsblatt erscheint künftig regelmäßig zu folgenden Terminen:
15. Januar, 15. Juli und 1. Oktober.
Im Januar 2024 wurde das Amtsblatt auf eine barrierefreie Version umgestellt. Die Printversion erschien letztmalig mit der Ausgabe zum 15. November 2023.
Das Landeskirchliche Amtsblatt kann weiterhin digital und kostenlos über die Seite www.kirchenrecht-braunschweig.de/list/kirchliches_amtsblatt abgerufen werden. Dort finden Sie auch das Sachregister 2023.
Anders als die gedruckten Exemplare und die PDF-Dokumente, die bisher auf der Seite zu finden sind, wird ab Januar 2024 ein einspaltiges barrierefreies Dokument zur Verfügung stehen. Eine umfangreiche Volltextsuche ist nun auch im Bereich „Amtsblätter“ möglich.
Ebenfalls neu sind die Zitiervorgaben für Rechtsvorschriften: Alle publizierten Rechtsvorschriften erhalten eine jährlich bei „1“ beginnende fortlaufende Nummerierung, die beim Zitieren zu berücksichtigen sein wird: Statt „ABl. 2023 S. 2“ lautet es künftig: „ABl. 2023 Nr. 1 S. 2“.
Die Webversion kann aus technischen Gründen keine Seitenzahlenangaben abbilden. Bei Bedarf können die amtlichen Fundstellen der PDF-Datei der Druckausgabe entnommen werden, bitte öffnen Sie zum Aufruf die Webversion der benötigten Ausgabe und klicken Sie das Druckersymbol in der Funktionsleiste an.
| Herausgeber: | Landeskirchenamt der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1, 38300 Wolfenbüttel, Telefon: 05331/802-0, Telefax: 05331/802-700, E-Mail: info@lk-bs.de www.landeskirche-braunschweig.de |
Redaktion: | Referat 30, Anja Schnelle, Telefon: 05331/802-167, E-Mail: recht@lk-bs.de |
Herstellung: | wbv Media GmbH & Co. KG, Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld |
Erscheinungsweise: | dreimal jährlich zum 15. Januar, 15. Juli und 1. Oktober |